
Liest man die großen Namen der Weimarer Klassik wie Johann Wolfgang Goethe und Friedrich Schiller, denkt man unmittelbar an die kunstvollen Dramen und Gedichte ihrer Zeit. Sie gehören nach wie vor zum Grundbestand des literarischen Kanons deutscher Literatur. Die aus dem Sturm und Drang hervorgegangene klassische Epoche erinnert an Goethes Faust, Schillers Kabale und Liebe, ihr aufeinander eingehendes gemeinsames Schaffen und die unbedingte Vorliebe für antike Vorbilder und Strukturen, die sie teilten. Denkt man dagegen an Theodor Fontane, fallen einem vermutlich zunächst seine Romane und die schulmäßige Zuordnung zum poetischen Realismus ein. Es wirkt doch so, als wären Fontanens Werke etwas grundsätzlich anderes als die Klassiker. Dabei sollte man indes nicht vergessen, dass Fontane noch zu Lebzeiten Goethes geboren wurde und dass keine 15 Jahre seit Schillers Tod vergangen waren. Fontanes Leben war in einem von der Klassik beeinflussten Zeitalter des 19. Jahrhunderts verankert, einer Kunstperiode, der Bertolt Brecht später eine „Einschüchterung durch die Klassik“ zuschreiben sollte. Wie, möchte man noch einmal fragen, war nun eigentlich das Verhältnis von Fontanes Realismus zu Schillers und Goethes klassischen Kunstauffassungen? Ließ sich Fontane tatsächlich auch von der so nachhaltig wirkenden Epoche einschüchtern?
 Natürlich lassen sich hier nur wenige Vermutungen anstellen. Furcht vor dem Normativen, das die klassische Periode auszustrahlen schien, ist bei ihm kaum zu bemerken. An einer gewissen Ehrfurcht mangelte ihm indes keineswegs. Der Künstler in ihm hatte Respekt vor dem hohen Kunstgrad, den er weder bei Goethe und schon gar nicht bei Schiller übersehen könnte. Sein aufgeschlossenes Interesse ist zweifelsfrei. Den unbedingten Kniefall sucht man bei ihm dagegen vergebens. Schillers Drama Die Jungfrau von Orleans etwa schätzte er. Das rührte wohl aus einer generellen Faszination der Figur der Jeanne d’Arc, welche sich nicht ausschließlich auf die Darstellung Schillers beschränkt.
Natürlich lassen sich hier nur wenige Vermutungen anstellen. Furcht vor dem Normativen, das die klassische Periode auszustrahlen schien, ist bei ihm kaum zu bemerken. An einer gewissen Ehrfurcht mangelte ihm indes keineswegs. Der Künstler in ihm hatte Respekt vor dem hohen Kunstgrad, den er weder bei Goethe und schon gar nicht bei Schiller übersehen könnte. Sein aufgeschlossenes Interesse ist zweifelsfrei. Den unbedingten Kniefall sucht man bei ihm dagegen vergebens. Schillers Drama Die Jungfrau von Orleans etwa schätzte er. Das rührte wohl aus einer generellen Faszination der Figur der Jeanne d’Arc, welche sich nicht ausschließlich auf die Darstellung Schillers beschränkt.
In Fontanes Roman Irrungen, Wirrungen finden sich in einer zentralen Szene, die den eigentlich zweisamen Ausflug Bothos und Lenes ins Grüne schildert, mehrere direkte Anspielungen auf Schillers Drama. Die Rede ist von den Kameraden Bothos, die das Paar auf ihrer Landpartie plötzlich und in hohem Maße unangenehm stören. Pitt, Serge und Balafré benennen ihre Begleiterinnen nach Dramenfiguren Schillers Johanna, Margot und Königin Isabeau. Botho vermag nicht zu widerstehen und stellt daraufhin Lene als „Mademoiselle Agnes Sorel“ vor. So hieß die Mätresse des französischen Königs Karl VII. Damit lässt er sich auf das soziale Spiel ein: er schlug sich das Gewand des Königs über und Lene muss sich in die Rolle einer Mätresse schicken:
[„] Gestatten Sie mir, Gaston, Ihnen unsere Damen vorstellen zu dürfen: Königin Isabeau, Fräulein Johanna, Fräulein Margot.“ Botho sah, welche Parole heute galt, und sich rasch hineinfindend, entgegnete er […] mit leichter Handbewegung auf Lene: „Mademoiselle Agnes Sorel.“ Alle drei Herren verneigten sich artig […], während die beiden Tächter Thibaut d’Arcs einen überaus kurzen Knix machten und der um wenigstens fünfzehn Jahre älteren Königin Isabeau eine freundlichere Begrüßung der ihnen unbekannten und sichtlich unbequemen Agnes Sorel überließen. (Irrungen, Wirrungen; S.92/93)
Es ist ein dunkler, aber ihn erhellender Moment für Bothos Charakter. Er zeigt sich unfähig, sein eigene Verunsicherung über Lenes Unwohlsein, das durch die sozialen Gepflogenheiten seiner Kameraden ausgelöst wird, zu stellen. Im weiteren Verlauf des Kapitels aus Irrungen, Wirrungen lassen sich weitere Parallelen zur Jungfrau von Orleans finden. Fontane schrieb außerdem neben den Anspielungen in seinem Roman über Schiller: „…, aber wer unter uns hätte den Mut, bedeckten Hauptes vor dem Genius stehen zu bleiben, der jene Werke schuf?“ (zit. n. Guarda, S. 504). Dieses Zitat drückt schlicht Respekt für den klassischen Dichter aus.
 Trotzdem zögerte Fontane keinen Augenblick, wenn er glaubte Missratenes oder Zeitfernes in den klassischen Texten entdeckt zu haben, das auch freiweg auszusprechen – ja, sogar drucken zu lassen. Dabei handelte es sich aber nicht um kritische Vorbehalte gegenüber den ‚klassischen Dichtern‘ schlechthin, sondern vielmehr um Kritik an jener Einschüchterung, von der manche Schriftstellerinnen und Schriftstellern der nachfolgenden Generation alles andere als frei waren. Fontane selbst dachte nicht daran, sich durch die großen Namen der Vergangenheit übermäßig beeindrucken zu lassen. Durchaus war er bestrebt, etwas Neues, von der Klassik Unabhängiges zu schaffen. Dazu gehörte eben die wirklichkeitsnahe Darstellung in seinen Romanen. „Wer wirklich lebt, will reales Leben sehen“ (Bahr, S.19).
Trotzdem zögerte Fontane keinen Augenblick, wenn er glaubte Missratenes oder Zeitfernes in den klassischen Texten entdeckt zu haben, das auch freiweg auszusprechen – ja, sogar drucken zu lassen. Dabei handelte es sich aber nicht um kritische Vorbehalte gegenüber den ‚klassischen Dichtern‘ schlechthin, sondern vielmehr um Kritik an jener Einschüchterung, von der manche Schriftstellerinnen und Schriftstellern der nachfolgenden Generation alles andere als frei waren. Fontane selbst dachte nicht daran, sich durch die großen Namen der Vergangenheit übermäßig beeindrucken zu lassen. Durchaus war er bestrebt, etwas Neues, von der Klassik Unabhängiges zu schaffen. Dazu gehörte eben die wirklichkeitsnahe Darstellung in seinen Romanen. „Wer wirklich lebt, will reales Leben sehen“ (Bahr, S.19).
So grenzte sich Fontane von den Klassikern ab, ohne ihnen jedoch den Rang ihrer besonderen Ästhetik abzusprechen. Die Weise zu schreiben und zu dichten, wie er sie bei Goethe und Schiller sah, schien ihm nicht mehr der eigenen Gegenwart gemäß. Das hieß natürlich keinesfalls, dass es keine Parallelen zwischen Fontane und der Klassik gibt. Ganz im Gegenteil, wie schon das Interesse an Schiller gezeigt hat. Gerade mit Goethe verbindet Fontane ein wichtiges Stilmittel, das der Ironie. Dieses literarische Verfahren zieht sich durch die meisten Werke Fontanes und ganz gewiss durch seine Romane. Auch für Goethe war Ironie allgegenwärtig. Ehrhard Bahr streicht in einem Aufsatz dabei die Phrase „Scherz und Ernst“ heraus, die neben Goethe bei Fontane und später nicht minder bei Thomas Mann zu entdecken sei. Fontane verfasste beispielsweise ein Gedicht mit dem Titel Ernst und Scherz, und Goethes bediente sich in seinem letztem bekannten Brief an Wilhelm von Humboldt der Formulierung „diese sehr ernsten Scherze“ (Bahr, S. 20). Für Goethe war, nicht anders als bei Fontane, die Ironie ein unerlässliches Mittel, um Kunstwahrheit zu stiften: im Faust ebenso wie in seinem Romanwerk Wilhelm Meister.
 Fontane stand es also fern, die Klassik kleinzureden oder verächtlich zu machen. Vielmehr begriff er sich gewissermaßen als jemand, der sich eines anderen Stils zu bedienen hatte, gemünzt auf eine andere Realität und eine neue Epoche. Der grundsätzliche Wandel in der Welt seit Goethe und Schiller zwinge schlicht dazu, veränderte Schreibformen auszuprügen und darstellerische Differenzierungstechniken ausfindig zu machen. Demnach sah sich Fontane nicht als Konkurrent zur deutschen Klassik. Von ihr konnte man lernen wie von den vergangenen Epochen. Aber man müsse akzeptieren, dass diese abgeschlossen waren, vergangen. Kann man – unter diesen Vorzeichen – also Fontane mit Goethe vergleichen? Wohl kaum oder in einem so allgemeinen Sinn, dass es unsinnig wird. Vielmehr liegt es ganz so, wie Fontane es selbst formuliert hat: „Goethe ist Goethe und Fontane ist Fontane.“ (Fontane an Julius Rodenberg, 18. Februar 1896).
Fontane stand es also fern, die Klassik kleinzureden oder verächtlich zu machen. Vielmehr begriff er sich gewissermaßen als jemand, der sich eines anderen Stils zu bedienen hatte, gemünzt auf eine andere Realität und eine neue Epoche. Der grundsätzliche Wandel in der Welt seit Goethe und Schiller zwinge schlicht dazu, veränderte Schreibformen auszuprügen und darstellerische Differenzierungstechniken ausfindig zu machen. Demnach sah sich Fontane nicht als Konkurrent zur deutschen Klassik. Von ihr konnte man lernen wie von den vergangenen Epochen. Aber man müsse akzeptieren, dass diese abgeschlossen waren, vergangen. Kann man – unter diesen Vorzeichen – also Fontane mit Goethe vergleichen? Wohl kaum oder in einem so allgemeinen Sinn, dass es unsinnig wird. Vielmehr liegt es ganz so, wie Fontane es selbst formuliert hat: „Goethe ist Goethe und Fontane ist Fontane.“ (Fontane an Julius Rodenberg, 18. Februar 1896).
Literaturangaben:
Theodor Fontane: Irrungen, Wirrungen. Texte Medien. Hrsg. von Peter Berkes, Volker Frederking. Schroedel, Braunschweig 2005.
Friedrich Schiller: Die Jungfrau von Orleans. In: Schillers sämtliche Werke in fünfzehn Bänden. Bd. 5: Maria Stuart. Die Jungfrau von Orleans. Cotta’sche Bibliothek der Weltliteratur, Gebrüder Kröner Verlagshandlung. Stuttgart, S. 155-284.
Erhard Bahr: Fontanes Verhaltnis zu den Klassikern. In: Pacific Coast Philology (1976), S. 15-22.
Sylvain Guarda: Fontanes travestierte „Pucelle“: „Irrungen, Wirrungen?“ In: German Studies (2007), S. 503-515.
Friedrich Gundolf: Goethe. Blaetter fuer die Kunst. 11. unveränderte Auflage, Georg Bondi Verlag, Berlin 1922.
Albert Koschorke: Identifikation und Ironie. Zur Zeitform des Erzählens in Goethes Wilhelm Meister. In: Empathie und Erzählung (2010), S. 173-185.
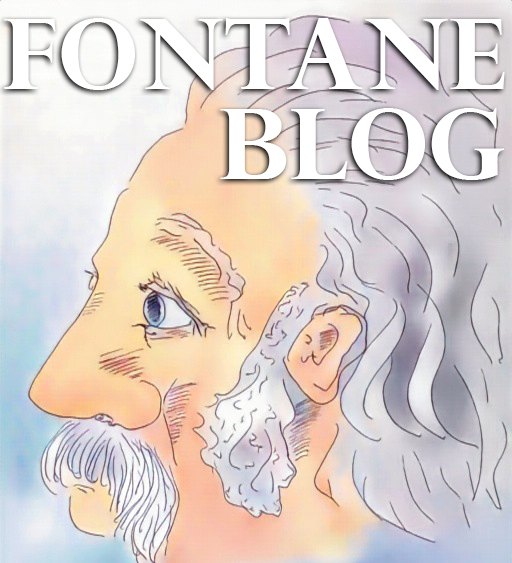
Mir gefällt an der Betrachtung, dass sie Fontanes Kenntnis und Wertschätzung Goethes und Schillers hervorhebt, von denen er Motive, literarische Gestalten
aufnahm, doch nicht „abschrieb“, sondern durchaus eigenständig umgestaltete.
Auch dass dieser zweite Gesichtspunkt gebührend gewürdigt wird, halte ich dem
Aufsatz zugute. Nach meinem Empfinden hebt das ihn wohltuend von manchen
anderen, wesentlich umfangreicheren Hintergrundaufhellungen ab, die diesen
Unterchied vernachlässigen und dadurch Th. F. in ein schiefes Licht rücken.