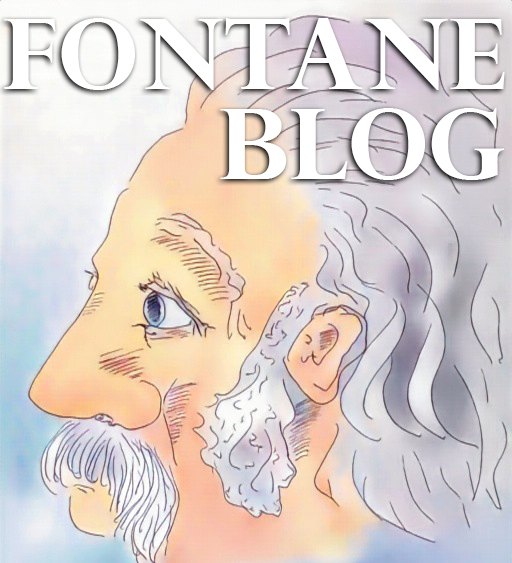„Ich bin farbenblind.“ Wir kennen uns seit wenigen Stunden und sprechen gerade über unterschiedliche Kulturen, Privilegien, Hautfarben, Hass, Liebe. Eigentlich sprechen wir über uns, was uns unterscheidet und was uns zusammenbringt. Hage kommt aus Namibia, er ist Künstler, Maler, um genau zu sein, und gerade in Deutschland wegen einer Performance an der Semperoper Dresden. Diese Performance nimmt er als Anlass, weiter durch Deutschland zu reisen. Er übernachtet bei mir während seines Zwischenstopps in Berlin. Wir reden über seine Erfahrungen in Deutschland und sprechen auch von Vorurteilen, mit denen er konfrontiert wird, und wie er ihnen begegnet. Hage schaut mich mit offenen Augen an und wiederholt: „Ich bin farbenblind“. In meiner kurzen Erregung über eine derartige Plattitüde, beginne ich einen Monolog über Unterschiede und ihre Schönheit. Viel zu prätentiös und am Thema vorbei. Weshalb dürfen uns Unterschiede nicht auffallen? Die Vielfalt öffnet, die Vereindeutigung verengt. Ich schmeiße mit Floskeln um mich, während er mich immer verdutzter anschaut. Irritiert unterbreche ich.

Später gehen wir auf einen kleinen Friedhof bei mir um die Ecke. Der Friedhof ist schlecht besucht und daher mein Lieblingsplatz, um zu lesen und in der Sonne einzuschlafen. Zu meinen Büchern packe ich einen Block, jede Menge Stifte und Gouache-Farben. Zwischen Bäumen und gar nicht so alten Grabsteinen breite ich eine Decke aus und setze mich. Hage macht es sich neben mir bequem, holt Block und Farben aus der Tasche, hält mir zwei unterschiedliche Rottöne entgegen und fragt, welche Farbe Rot sei. Etwas verunsichert überlege ich, welcher der beiden Rottöne der Farbe Rot mehr entspricht, und deute auf meine Entscheidung. Danach holt er zwei Blautöne heraus und fragt mich, was davon die Farbe Blau sei. Ich überlege, ob das eine fast schon philosophische Frage ist, entscheide mich für den meinem Empfinden nach blaueren Farbton und ahne es schon. Als er mir wenige Sekunden später zwei Gelbtöne unter die Nase hält, muss ich endlich mit schon peinlicher Gewissheit nachfragen: „Wieso fragst du?“ Verzweifelt und leicht gereizt wiederholt er sich und sagt: „Ich bin farbenblind.“ Wie unangenehm, ich lächle ihn verlegen an, drehe mich auf die Seite und widme mich meinem Buch. Er fängt an zu malen, während ich noch länger über dieses Missverständnis nachdenke und versuche, mir gegen jedwede Vernunft einzureden, dass er es nicht bemerkt hat.

Der Tag auf dem Friedhof ist besonders. Hage malt, ich lese, wir hören Musik. Irgendwann malt er auch ein Bild von mir. Ich bin beeindruckt, nicht unbedingt wegen der Ähnlichkeit, eher überrascht mich die Stimmung, die er auf der Zeichnung einfängt. Wir verstehen uns, werden Freunde über den Tag. Abends ruft er mich an, er reist spontan weiter.
Ein paar Wochen später sitze ich im Seminar und wir diskutieren lebhaft die Zeichnung unseres Seminarleiters für das Logo des Fontane-Blogs. Der Einwand eines Kommilitonen, Fontane sähe darauf eher aus wie Albert Einstein, ist nur schwer von der Hand zu weisen. Der festen Überzeugung, man sollte eine derartige Verwechslungsgefahr vermeiden, und mit der Gewissheit, es selbst wahrscheinlich nicht besser hinzukriegen, denke ich an meinen neu gewonnenen Freund, der schon wieder zurück in seiner Heimat Namibia ist.

Als ich vorschlage, Hage zu bitten, für uns ein Portrait zu malen, wird mir bewusst, dass Hage und ich uns eigentlich gar nicht kennen. Wir stehen in regelmäßigem Kontakt, doch genau genommen, hatten wir nur diesen einen Tag auf dem Friedhof. Zwei Wochen später traue ich mich, ihn nach einem Fontane-Porträt zu fragen. Er hat keinen Schimmer, von wem die Rede ist, er fragt auch nicht weiter. Trotzdem lege ich los. Als ich anfange zu erzählen, wird mir klar; Hage ist in seinem Unwissen, wer eigentlich dieser Theodor Fontane ist, nicht allein. Was weiß ich schon. Je länger ich darüber nachdenke, umso weniger wird es. Während Hage eine gute Entschuldigung hat, überlege ich, was meine sein könnte.
Wenige Stunden nach unserem Telefonat erhalte ich einen ersten Entwurf.