„Der Herr hat heute Kritik“ soll die Bedienstete Fontanes schon im Treppenhaus ungelegene Besucher abgefertigt haben. Das hieß: In den Königlichen Schauspielen auf dem Gendarmenmarkt war ein neues Stück gegeben worden, und der Theaterrezensent der Vossischen Zeitung hatte es zu besprechen. Offenbar ein Geschäft höchster Konzentration, nichts leichthin zu Erledigendes. Da liegen bei mir die Dinge ganz anders. Zwar habe ich gestern (19. September 2018) auch eine Bühnenpremiere erlebt und schicke mich an, ein Wort dazu zu sagen. Aber auf meinem Flur wird niemand abgefangen, kein mutmaßendes Raunen vor meiner Tür, niemand wartet auf mein Votum. Verbindet mich eins mit Fontane, dann jenes „ThF“ für „Theater-Fremdling“.
Allerdings: Wer mir am Mittwoch im Theater An der Parkaue bei der Uraufführung von „EFFI“ begegnet ist, und mich bei der Nachfeier sah, er wird mich – vielleicht – für einen Insider gehalten haben: einen, der dem Intendanten und Regisseur Kay Wuschek herzlich die Hand schütteln durfte, der mit dem Dramaturgen Oliver Schmaering freiweg plauderte und sich, als sei es damit noch nicht genug, von den beiden Hauptdarstellerinnen, Kinga Schmidt und Sophia Hankings-Evans, angelegentlich verabschiedete, als sei das sein angestammtes Recht. Mitnichten. Das dünne Brett, das Halt verhieß, waren drei, vier Begegnungen vor und während der Proben zum „Effi“-Stück im Parkauen-Theater: ein unbekümmert-frisches Brainstorming im Café LEON im Frühjahr, eine mehrstündige Szenenprobe in Rummelsburg und ein völlig verunglückter erster Durchlauf ohne Regisseur und mit einer fehlenden Hauptdarstellerin in der vergangenen Woche.
Das alles tut wenig, fast nichts zur Sache. Die drehte sich um jenen Roman Fontanes, der 1894/95 im Erstdruck in der Deutschen Rundschau und 1896 als Buch im Verlag seines Sohnes Friedrich erschienen war. Nicht wenigen gilt er als Fontanes Meisterwerk. Hier und da fällt das Wort „Bestseller“, Fontane hätte gelächelt. Er habe den ersten Entwurf „träumerisch und fast wie mit einem Psychographen geschrieben“, gestand er dem Verlegersohn Hans Hertz am 2. März 1895. Und hoffte, dass seine Leserschaft das feingestrickte und -gewirkte Flechtwerk wahrnahm, mit dem er alles und jedes in dieser Erzählung verknüpft hatte. Tränen sind Generationen von Lesenden geflossen, vielleicht fließen sie noch immer. Und die Literaturgeschichte, mit dem „Epochenbegriff des poetischen Realismus“ jonglierend, hat Effi Briest in den literarischen Adelsstand erhoben. Über deren Rang ist man sich urteilseinig.
Beschrieben wird das Schicksal Effi Briests, die als siebzehnjähriges Mädchen auf Zureden ihrer Mutter den mehr als doppelt so alten Baron von Innstetten heiratet. Dieser behandelt Effi nicht nur wie ein Kind, sondern vernachlässigt sie zugunsten seiner karrierefördernden Dienstreisen. Vereinsamt in dieser Ehe, geht Effi eine flüchtige Liebschaft mit einem Offizier ein. Als Innstetten Jahre später dessen Liebesbriefe entdeckt, ist er außerstande, Effi zu verzeihen. Zwanghaft einem überholten Ehrenkodex verhaftet, tötet er den verflossenen Liebhaber im Duell und lässt sich scheiden. Effi ist fortan gesellschaftlich geächtet und wird sogar von ihren Eltern verstoßen. Erst drei Jahre später sind diese bereit, die inzwischen todkranke Effi wieder aufzunehmen.
Die Frage, vor der Wuschek, Schmaering und das Schauspielensemble standen: Was soll das Ganze 2018? Man wollte um Gottes willen nichts nacherzählen und um keinen Preis sich sklavisch an Fontanes Vorgabe halten. „Nach Fontane“ heißt es in den Ankündigungen, „in einer Fassung von Oliver Schmaering und Kay Wuschek“. Damit hatte man sich Freiraum erwirtschaftet. Ist er genutzt worden? Über die Zielgruppe ist sich das Junge Staatstheater (wer ist nur auf diesen Namen gekommen?) weitgehend klar: junge Leute, höhere Schulklassen, möglicherweise und möglichst gut präparierte, und die unverwüstlichen, ewig jungen Liebhaberinnen und Liebhaber Fontanes. Ein Blick ins Publikum stellte fest: Ja, genau die hatten sich zusammengefunden, erwartungsfreudig, plauderfroh.
Das Bühnenbild – wie die Kostüme leicht und unangestrengt entworfen von Joachim Hamster Damm – gefiel, eine Drehbühne, eine weiße Türenreihe, Vorhänge, ein angedeutetes Zimmer mit einer großen Tür am Ende. Umstandslos konnten die Spielenden die Bühne betreten und ebenso umstandslos wieder abtreten. Moderne Musikeinspielungen, Filme, Bildprojektionen – diese Mittel gehören zum üblichen Standardarsenal. Sie überraschen niemanden mehr. Und keiner ist wirklich überrascht, wenn eine Figur mit zwei Schauspielerinnen besetzt ist oder ein Schauspieler mehrere Rollen in sich vereint. Slapsticks als Einlagen werden so selbstverständlich aufgenommen wie ein Bänkelsänger (Filip Grujic, der Szenenapplaus erhält, als er, hier anstrengungslos, eine Art „Effi“-Moritat zur wunderbar gespielten Gitarre sang). Wuschek setzt diese Mittel ein, mit sicherer Hand – und unbedenklich löst er auch die Chronologie auf, ja löst die Schauspielerinnen und Schauspieler zuweilen von ihren Rollen. Dann treten sie aus dem Spiel und geben sich selbst. Damit ist jenes „nach Fontane“ gewissermaßen ins Bild übersetzt. Man geht mit, auch wenn da Klamauk droht und das Virus des „Comedian-tums“ sich einschleicht. Ohne Scheu werden fast klassisch angelegte Szenen mit Alberei verwoben. Eben blödeln noch zwei Politiker-Karikaturen vor einem Konferenzraum, da schwebt schon ein philosophisch-psychologisch-pathologischer Wortfluss durch den Raum, der an Lacan oder Foucault erinnert – unverbunden. Man kann das machen, warum nicht. Das jüngere Publikum ging damit locker um. Jede/r bekam etwas, keiner ging leer aus. Wer in das Spiel kommen wollte, fand seinen/ihren Zugang. Aufführungspraktiken wollen und können nicht „aus einem Guss“ sein. Sie leben von der offenen Struktur, die sie erzeugen und auf deren inneren Halt sie angewiesen bleiben.
Klingt in diesem Wenigen schon der Theaterfremdling durch? Sicher. Aber er saß nicht kopfschüttelnd auf seinem Klappsitz, nicht miesgrämig. Einige Szenen verzauberten ihn – von ihnen hätte er gar nicht genug bekommen können: etwa das Spiel der beiden Effis, als der Gedanke an ein eigenes Kind aufkommt. „Ich will ein Kind“ variierte Sophia Hankings-Evans so unbeirrbar-intensiv wie Kinga Schmidt verängstigt-messerscharf alle Gründe dagegen auflistete, es ist „ein Provisorium“ – oder wie Denis Pöpping als Crampas Varianten seines glückhaft-verunglückenden Lebens mit Frauen vorführte (obgleich Pöpping vom Fontane’schen Crampas nichts, aber auch gar nichts hat) – oder wie die Bühne, am Ende sich immer rascher drehend, die beiden Effis im Sterben wie im Aufbrechen zeigte.
Und „Innstetten“? Richtig, bisher kein Wort zu Geert von Innstetten. Fontane hat die Figur vor dem Zorn seiner Leserinnen geschützt, der erschien ihm ungerecht. Hier spielt ihn Jakob Kraze, ein erfahrener Schauspieler, der das Lebensalter Innstettens um ein Beträchtliches hinter sich hat. Er konturiert seine Rolle mit fließenden Grenzen – ein Zug der Inszenierung überhaupt, eine ihrer Grundideen. Den Frauen ist Innstetten kein ernsthafter Widerpart. Ist das beabsichtigt? Vielleicht. Seine Anker sind lose – das merkwürdig überzeichnete Schluchzen, als er die verräterischen Briefe in den Händen hält, irritiert. Schauspieler und Rolle vereint Ratlosigkeit. Diese Figurenanlage verschenkt etwas. Innstetten bleibt wichtig und muss Gewicht haben – selbst wenn die Umstände (welche eigentlich?) auch ihn zu einem Wichtelmännchen herunterwirtschaften.
Vor allem am Anfang diktiert die Inszenierung eine gewisse Forciertheit. Die Heftigkeits- und Bemühtheitsschraube wird zu weit gedreht. Wo sie aber gelockert wird, wo das Eruptive gedrosselt wird – und wo dem Wort, das einige feine Qualitäten aufweist, vertraut wird wie der leisen Geste, da gelingen dieser Aufführung schöne Szenen, voller Kraft. Da öffnet Effis Spiel verführerisch unser Herz, um es gezielt gleich wieder zu verschließen. Sie zieht uns an und stößt uns ab – wenn es glückt, in einem Wimpernschlag. Die geschliffene Männer-Revuenummer, die offenbart, dass eben auch die Männer nicht nur Täter oder Tölpel, sondern gleichermaßen Opfer sind, gehört dazu wie der Effi-Monolog, in dem sie alles will, absolut alles. Biedere Vernunft mag beschwichtigen: „Kind, man kann nicht alles wollen – und wer alles will, hat am Ende nichts“. Und dann wird man heimgesucht von Alpträumen, wirft sich in seine Kissen, wirbelt unter dem Vorhang als die eine Effi hervor, um als die andere zurückgeschleudert zu werden. Eine beklemmend gelungene Szene. Beschwichtigen, nein, beschwichtigen will diese Aufführung nicht.
Fontanes Effi Briest bietet das Sprungbrett, um zu dem zu gelangen, was Regisseur, Dramaturg und vor allem Kinga Schmidts Effi bewegt. Diese Figur ist herausgelöst aus der Zeit, die sie fand und sich erfand. Erlöst ist sie nicht. Man ist hellwach, wo die Schaukel-Effi nicht heruntergezogen wird ins verdrechselte Wilhelminisch-preußische Reich, sondern ihr mythisches wie alltägliches Wesen entfaltet. Gültig gestern, heute und morgen. Borniertes Preußentum erklärt nicht ihren Zauber, und der hält an, wenn diese Effi nur dasteht, traurig und schuldig, Blut am Mund, das echt wirkt – sowie das von Crampas Ketchup gleicht.
Der „Theater-Fremdling“ legt die Feder beiseite. Wäre sie echt, wär’s eine Gänsefeder, selbst geschnitten (keine Stahlfeder wie im eingespielten Filmchen). Noch einmal vergegenwärtigt er sich den Abend und sieht die entspannten, schönen Gesichter – und ist neugierig, wie jene urteilen, die etwas davon verstehen (etwa Eva Förster in Märkische Oderzeitung-Effi). Da muss er mit einem Mal schmunzeln. Erst jetzt fällt ihm auf, dass ein Satz, nein, nicht ein, sondern DER Satz fehlte. Das ist ja sonderbar, murmelt er und lächelt stillvergnügt.
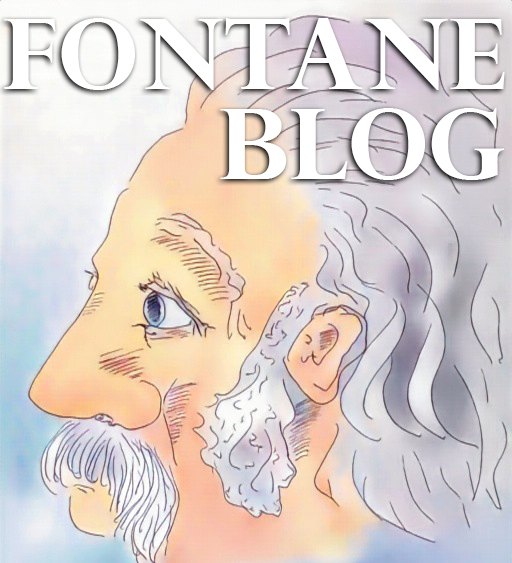
Servus sehr geehrte leserinnen und leser,
Mein name ist Erik Richter ich fand das Stück sehr sehr sehr …..
ich würde es mir noch 10 mal reinziehen die geile scheisse
Sogar conchita wurst war drinne zu sehen