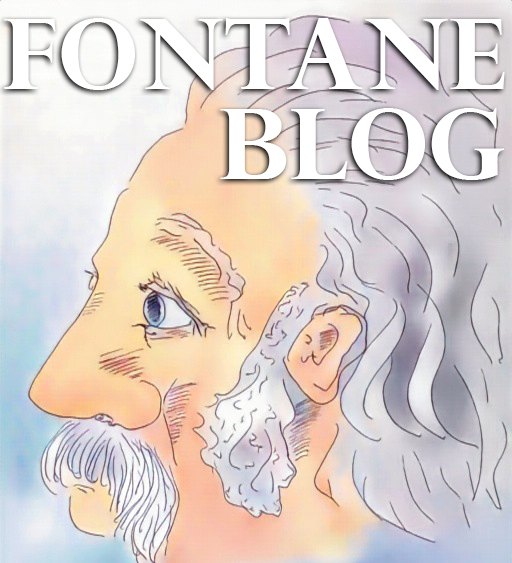VON HARRY NUTT
Die Idee zu den Wanderungen durch die Mark Brandenburg kam Fontane im fernen Schottland. Dort, am Loch Leven in den Central Lowlands, tauchte vor seinem geistige Auge plötzlich wie eine Fata Morgana das Schloss im nordbrandenburgischen Rheinsberg auf. Das Bild schien sich ihm nachhaltig eingeprägt zu haben, denn in Die Grafschaft Ruppin heißt es über das kleine Wasserschloss in Rheinsberg: „… und ein Schloss stieg auf mit Flügeln und Türmen, mit Hof und Treppe und mit einem Säulengange, der Balustraden und Marmorbilder trug.“
Sätze wie diese nehmen heute viele Flecken in Brandenburg für sich in Anspruch. Fontane hat die eher dünn besiedelten Region derart vollständig kulturell kartografiert und veredelt, wie es heute wohl keine Imagekampagne für die Erschließung einer neuen touristischen Region zustande bringen würde. Das Fontane-Jahr 2019 wird also auch ein Brandenburg-Jahr werden, ein Fest für Krentzlin, Kremmen, Kossenblatt und Neu-Globsow. Kaum etwas ist ihm entgangen, und wohin Fontanes Weg in den Wanderungen nicht führte, tut man sich heute schwer, sich er Region zugehörig zu fühlen. Das ist paradox genug, denn das Fontane‘sche Denken und Schreiben folgte keineswegs einem allzu zwanghaft geratenen Vervollständigungsdrang, wie umfangreich ihm das eine oder andere Werk auch geraten sein mag. Vielmehr vertraute er den Launen und dem Zufall, und in einem Brief an Georg Friedlaender bekannte er sich zu einem in Abwandlungen immer wiederkehrenden Motto, das für sein Leben ebenso gilt wie für sein literarisches Schaffen: „Ich lasse mich gern treiben und warte wo die Welle mich landet.“ Dieses Sich-Treiben-Lassen verstand Fontane allerdings nicht als programmatische Absicht, sondern es war eher ein Gegenbegriff zur charakterlichen Forschheit oder der, wie er es nannte, Forscheté. Er habe „keine starken Nerven, das Leben zu zwingen“, gestand er seiner Frau in einem Brief, und an Friedlaender schrieb er, eher wolle er lieber „alles ruhig laufen lassen.“
Ein ruhiges Dahinlaufen der Zeit ist es oft auch, was Fontanes Texten eine zeitlose Aktualität verleiht. Für den Moment geschrieben, wohnt ihnen eine über die Zeit hinausweisende Gültigkeit inne. Ganz ohne dergleichen sein zu wollen, sind Fontanes Journale und Erzählungen fast immer auch soziologisch genaue Gesellschaftsbilder. „Finden, nicht erfinden“, so hat Fontane es in seinem autobiografischen Von Zwanzig bis Dreißig gewissermaßen als ästhetisches Programm dargelegt: „In der Erzählkunst bedeutet es beinahe alles“. Angestrengtes Suchen indes geht meistens schief. „Bei mir müssen sich die Dinge immer finden“, schreibt Fontane in einem Brief an Mathilde von Rohr, „suche ich sie auf, so scheitre ich in der Regel.“
Der Selbsterkenntnis, dass ehrgeiziges Wissenwollen zu nichts führe, geht bei Fontane allerdings mit einem beinahe grenzenlosen Vertrauen einher, die Musen auf seiner Seite zu wissen. Wie sonst soll man es deuten, dass derjenige, der sich gern treiben lässt, wartet wo die Welle ihn landet. Der zeitgenössischen Lektüre Fontanes wohnt heute unweigerlich die Ahnung inne: Er war immer schon da.
Anm.: Dieser Text erschien zuerst in der Berliner Zeitung Rubrik Unterm
Strich/Fontane der Woche.