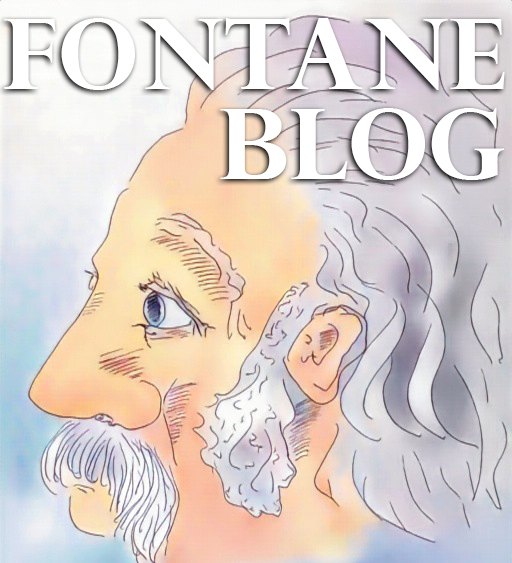VON INGEBORG RUTHE
Januarblues und Augustwind sind, das weiß ich jetzt definitiv, keine Ein- und Durchschlaf-Mixtur. Aber ich hatte mir während der Störungen meines Biorhythmus‘, in Erinnerung des 200. Geburtstages von Theodor Fontane und in der Hoffnung, sowas „Altes“ aus überholten Zeiten würde mich wieder einlullen, „Effi“ aus dem Regal geholt – bei Proust war mir das schon mal gelungen.
Es geht bei diesem unvergleichlichen, gleichwohl von späteren Berühmtheiten (Thomas Mann, Günter Grass, Günter de Bruyn) belehnten märkisch-preußischen Dichter meist um Herzschmerz und zwischenmenschliche Belange. Zugleich hat sein Realismus einen doppelten Boden, wegen der Figuren und ihren Brüchen, ihrem Scheitern an den Konventionen und dem Wilhelminischen Moralkodex.
Effi war so eine komplett Gescheiterte, die im elterlichen Garten, unter den alten Platanen auf der Schaukel ihrer Kindertage sitzt, sich noch einmal hochschwingt und sich dennoch fühlt „wie ein Blatt, das der Augustwind schon vom Baum gerissen hat“. Fontane selbst empfand tiefstes Mitleid, schrieb, nachdem er um 1894 den letzten Satz des Romans Effi Briest mit einem Punkt versehen hat, an den Freund Hertz: „Ja, die arme Effi! Vielleicht ist es mir so gelungen, weil ich das Ganze träumerisch und fast wie mit einem Psychographen geschrieben habe.“
Effis gescheiterter Traum von der Liebe zum fremden Major – die Affäre passierte bekanntlich, weil ihr Gatte sie nicht nur wie ein Kind behandelte, sondern zugunsten seiner Karriere auch grob vernachlässigte – seufzt sich weg wie ein Windstoß auf der Schaukel. Es kommt, was kommen muss: Der leichtlebige Geliebte vom Gatten im Duell erschossen, Effi verstoßen und geächtet.
Die freie Natur wird ihr zum fernen Sehnsuchtsort. Die ernüchterte Illusion steckt im Käfig der Gefühle und Gedanken. Effi, Tochter der Luft in Blau, Weiß und dunklem Rot, sollte nach ihrem Sündenfall und nach dem Willen der Eltern und des gehörnten Ehemanns Baron von Innstetten demütig verloren gehen in Spitzendeckchen, trockenen Blüten, Vogelfedern, Briefen, Schleifen.
Um diese kleine Welt herum wehen Vorhänge und Gedanken wie die Schwingen ausgestopfter Vögel. Und die streiften mich ständig, machten es mir unmöglich, wieder einzuschlafen unter der Bauhauslampe, nach jedem Satz im Effi-Roman. Der Dialog zwischen den handelnden Personen und den Dingen zerbröselte durch die Trockenheit der Umwelt. Effi konnte nicht frei werden. Sie war von Kleinheit umgeben. Und das ist nicht bloß eine Situation des 19.Jahrhunderts. „Gott ist klein geworden. Alles, was klein ist“, sagt Fontanes Effi, „ist grausam.“
Der Gedanke an den grausamen Schöpfer war es, der mich beim Lesen unter der Bettleuchte immer wacher, aufgeregter werden ließ: Der von der jungen Effi einst ausgekostete Reiz des Gefährlichen, auf der Schaukel auf diesem wackeligen Gestell hoch zu fliegen, immer mit dem Gefühl, abzustürzen und doch immer wieder aufgefangen zu werden, wie schmeckt der doch schal nach dem Resignieren. Diese lebensmüde, vorzeitig alt gewordene Effi, da in Hohen-Cremmen auf der Kinderschaukel, erschien mir als starke, beunruhigend zeitlose Metapher für Menschen, Frau oder Mann, die es aufgegeben haben, etwas zu verändern, sich mutlos dreingeschickt haben in grausamer Kleinheit. Ich lese die Effi jetzt nur noch bei Tage.
Anm.: Dieser Text erschien zuerst in der Berliner Zeitung Rubrik Unterm
Strich/Fontane der Woche.