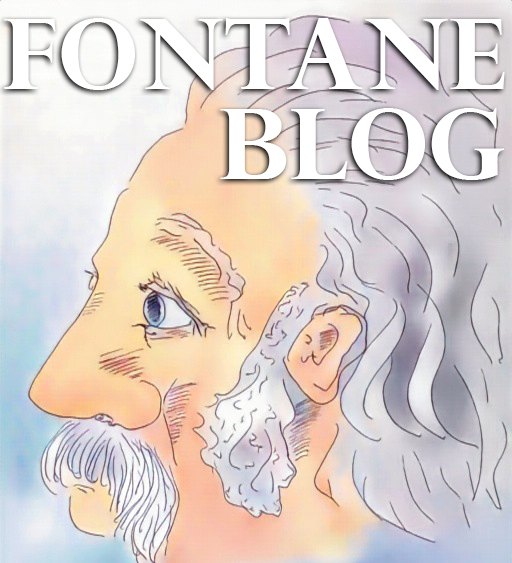Heutzutage wird die Idee des Weltbürgers hauptsächlich mit der Großstadt assoziiert: Man denkt an multikulturelle Städte, wie Berlin, New York oder Hong Kong, wo Menschen aus aller Welt wohnen und arbeiten. Und weil das jetzt so ist, nehmen wir an, dass es auch schon immer so war: Von überallher zogen die Menschen schließlich nach Rom, Konstantinopel, Bagdad und Chang’an. Da wir auch daran gewöhnt sind, binär zu denken, nehmen wir wiederum auch an, dass in der Kleinstadt die genau entgegengesetzte Situation herrschte. Multikulti in den Städten; in der Provinz eben provinziell.
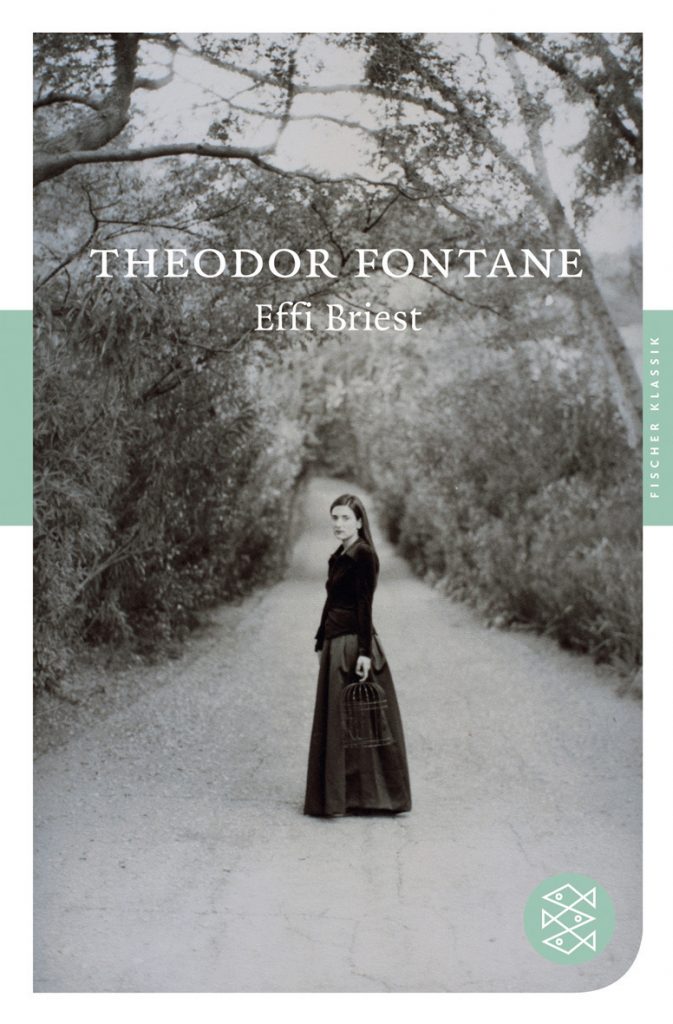
Bei der Relektüre von Fontanes Effi Briest kam mir dieser Gedanken mehrmals entgegen – denn dort stimmt es nicht. Das Berlin, das im letzten Drittel des Romans dargestellt wird, ist eine Stadt, die sich in einem enormen Wachstumsprozess befindet (in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts wuchs die Berliner Bevölkerung um mehr als 400%). Der Zuzug an Menschen nach Berlin und das räumliche Wachstum Berlins sind so immens, dass Instetten sein Frau Effi scherzend beschwichtigen muss, dass es in Berlin keine Spukhäuser gebe, wenn diese das Haus in Kessin wegen eines Spuks fürchtet – denn er wisse nicht, wo ein Spuk bei den ganzen Menschen dort herkommen solle. (EB, 192f.) Und tatsächlich dürfen sie in einer Wohnung wohnen, in der niemand gestorben ist und ziehen in einen Neubau in der Keithstraße ein. (EB, 206)
In ihrem Berliner Leben als Ministerrat und Ministerrätin verkehren Effi und Innstetten mit den besseren Kreisen der High Society, die sich um die kaiserliche Regierung drehen. Erst nach sieben Jahren, und nachdem Effis Affäre mit Crampas offenbart wird, kommen die Neuankömmlinge in Berlin sehr flüchtig in das Blickfeld dieses Umkreises, als Effi eine kurze Zeit in einem Pensionat mit fünf anderen Frauen verbringt: „zwei die Hochschule besuchende Engländerinnen, eine adelige Dame aus Sachsen, eine sehr hübsche galizische Jüdin, von der niemand wusste, was sie eigentlich vorhatte, und eine Kantorstochter aus Polzin in Pommern, die Malerin werden wollte“ (EB, 274). Sie zieht zwar schnell aus, aber diese fünf Frauen, die aus dem Ausland und aus anderen Regionen des Kaiserreichs nach Berlin gezogen sind, bieten einen schlagartigen Einblick auf eine andere, internationale und nicht amtliche Seite Berlins um 1890.
Während die Gesellschaft außerhalb von Effis Sphäre im Berliner Teil des Romans nur kurz erwähnt wird, geraten die in der fiktionalen pommerschen Küstenstadt Kessin lebenden „Menschen aus aller Welt und Ecken“ (EB, 47) immer mehr in den Fokus des Geschehens. Der Kosmopolitismus Kessins, der Ort, der oft als Nest bezeichnet wird, lässt ihn für Effi nicht nur psychologisch, sondern auch buchstäblich zu „einer fremden Welt“ werden (EB, 93). Diese Fremdheit wird deutlich anhand der Kessiner Figuren: Der beste Freund, Alonzo Gieshübler, dessen Name „eine ganz neue Welt vor einem“ aufschließe (EB, 66), ist Sohn einer Andalusierin; die Sängerin, Marietta Trippelli, sei „gut deutsch“ (EB, 91) und geborene Kessinerin, aber nimmt einen exotischeren, italienisierten Namen an, um ihre musikalische Karriere zu fördern – ihre Durchreise nach Russland über Kessin unterstreicht die Nähe zum Ausland.
Aber auch schon bei ihrer Ankunft kommt die Andersartigkeit Kessins zum Vorschein: So ist die erste Person, die Effi von der Kutsche aus sieht, ein Gastwirt namens Golchowski, den sie sich aufgrund seiner Pelzmütze als slawischen Starosten vorstellt. Innstetten erläutert, er sei „ein halber Pole“ und ein für den Wahlkampf nützlicher Vermittler. Kurz darauf erzählt er weiter von den Kaschuben, die seit einem Jahrtausend in der ländlichen Umgebung wohnen, sowie von mehreren Konsuln, die die Handelsinteressen verschiedener europäischer Länder, der Vereinigten Staaten und Chinas vertreten. Effi erwidert darauf mit der Frage, ob man gelegentlich Afrikaner, Türken oder Chinesen in Kessin sehe. (EB, 46ff.)
Diese letzte Frage bringt in Erinnerung, dass der Roman sich zu Zeiten des europäischen Kolonialismus abspielt, der sich mit der Kongokonferenz in Berlin zwischen 1884 und 1885 zum „Wettlauf um Afrika“ entwickelte. Diese Geschichte bleibt zwar im Hintergrund, tritt aber an verschiedenen Stellen hervor: Beispielsweise hat ein Gehilfe den Spitznamen Mirambo (EB, 86), nach dem als ‚Napoleon von Afrika‘ beschriebenen Hauptmann, der um den Tanganyikasee im 1885 gegründeten Deutsch-Ostafrika lebte. Dieser Name, der wohl literarisch aus der Afrikaforschung stammt, steht exemplarisch für den Kolonialismus in Kessin. Zudem nahmen andere Kessiner ebenso an Kolonialunternehmungen teil: Doktor Hannemann war ein Schiffschirurg auf einem Grönlandfahrer (EB, 156); Kapitän Thomsen war Seeräuber (EB, 49) und „viele Jahre lang ein sogenannte Chinafahrer, immer mit der Reisfracht zwischen Shanghai und Singapore“ (EB, 88) unterwegs. Und zudem kam er nach Kessin in Begleitung eines unbenannten Chinesen, dessen vermutlicher Spuk Effi verfolgt.
Wenn die Beschreibung des Chinesen teilweise kolonialistische und heutzutage (und gelinde gesagt) ein als extrem einzustufende Klischee widerspiegelt, indem er als eine von sehr wenigen Figuren ohne Namen dargestellt wird, und Effi behauptet, ein „Chinese […] hat immer was Gruseliges“ (EB, 48), dann darf nicht vergessen werden, dass er immer in Dialogpassagen und nicht von der Erzählinstanz geschildert wird. So betrachtet, muss nach anderen Aussagen gesucht werden, um zu überprüfen, ob dieser Behauptung auch widersprochen wird. Beispielsweise soll der Pastor gesagt haben, als der Chinese starb: „man hätte ihn auch ruhig auf dem christlichen Kirchhof begraben können, denn [er] sei ein sehr guter Mensch gewesen und genauso gut wie die anderen“ (EB, 90). Später erkennt auch Effi, dass die Spukgeschichte eine Projektion ihres eigenen Gewissens ist (EB, 178); darüber hinaus kommt Roswitha als Zentrum der Standhaftigkeit und Treue zu der Meinung: „die Chinesen sind doch auch Menschen, und es wird wohl alles ebenso mit ihnen sein, wie mit uns“ (EB, 183). Wenn die Äußerungen über den Chinesen anfangs auf Vorurteilen beruhen, werden sie am Ende – allerdings den zeitgenössischen Sitten gemäß – auch eingeschränkt.
Der Blick auf die Welt und jenseits der Grenzen Deutschlands im Roman entspricht schwer unseren heutigen Assoziationen, die wir mit dem Gefüge zwischen Großstadt und Weltbürgertum verbinden. Während der Zuzug aus anderen Regionen und Ländern nach Berlin flüchtig angedeutet wird, ist die Anwesenheit von Menschen aus aller Welt und Ecken im kleinstädtischen Kessin viel deutlicher. Diese Internationalität mindert weder die Einsamkeit, die Effi dort empfindet, noch die Heimtücke der Adligen – der damaligen Klassengesellschaft: Er macht jedoch klar, inwieweit die Weltgeschichte des späten 19. Jahrhunderts sich auch in den kleinsten Nestern erleben lässt.
Seitenangaben nach der Ausgabe: Theodor Fontane: Effi Briest. Frankfurt a. Main: Fischer (Klassik) 2018.