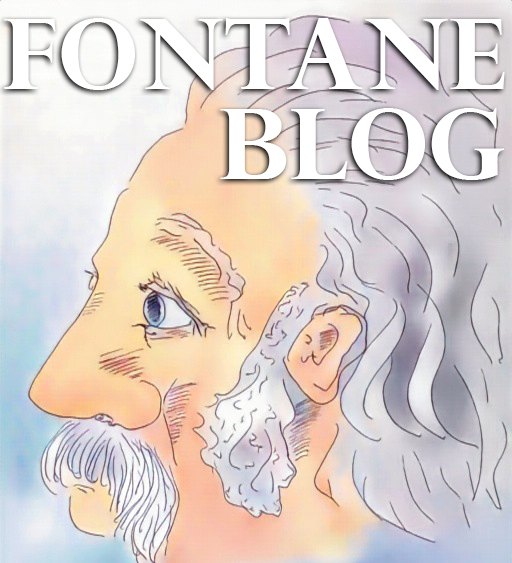Am Donnerstag, 28. November 2019, lud der Bürgermeister von Neuruppin, Jens Peter Golde, in den Ratssaal der Stadt ein. Der Anlass war bedeutend und angenehm in einem. Es galt dem Erscheinen des Sonderpostwertzeichens „Fontane“ einen würdigen Empfang zu bereiten. Der Saal war hübsch eingerichtet, freundliche Gesichter überall. An einer Front des Raumes hatte man in übergroßem Format die Fontane-Briefmarke aufgestellt. Staatssekretär Werner Gatzer im Bundesfinanzministerium, dort zuständig für den Bereich Bundeshaushalt, Zentralabteilung, Privatisierungen, Beteiligungen und Bundesimmobilien, hatte es – wie es so schön heißt -, nicht nehmen lassen, anlässlich dieses kleines Festaktes in die Fontane-Stadt zu kommen. Ein Zeichen von Wertschätzung. In der ersten Reihe saß die Leipziger Künstlerin Grit Fiedler. Von ihr stammt der Entwurf zu diesem Sonderpostwertzeichen.

Der Bürgermeister fand, wie bei allen Anlässen in diesem Fontane-Jahr, das rechte Wort, freundlich und ohne alle Prätention (ganz nach Geschmack des Jubilars) – und nicht minder der Staatssekretär. Er führte noch einmal vor Augen, dass das, was uns in diesem Feierjahr Selbstverständlichkeit schlecht hin ist, alles andere als das ist. Dieses Sonderwertzeichen hatte sich gegen gehörige Konkurrenz durchzusetzen. Es gelang, nicht zum ersten und hoffentlich auch nicht zum letzten Mal. Mag man über den Fontane auf der Briefmarke streiten wie weiland über das Logo dieses Blogs – dass sie da ist, freut.
Vanessa Brandes und der Verfasser dieses Beitrags waren gebeten worden, zu jener Premiere im Neuruppiner Ratssaal eine kleine Rede zu halten: eine Ehre. Es sollte um den Brief bei Fontane gehen, nicht mehr, nicht weniger. Die Theodor Fontane Gesellschaft hatte sich an diese Initiative beteiligt, namentlich Eberhard Schomer, jahrelang Leiter der Sektion in Erlangen. Wir erlauben uns, diesen Text hier allen Blog-Leser*innen vorzulegen.
„Meine sehr verehrten Damen und Herren, geschätzte Fontane-200-Freundinnen und -Freunde, und vor allem versammelte Liebhaberinnen und Liebhaber von Sonderpostwertzeichen,
fast geht das Fontane-Jubiläumsjahr zur Neige, fast regten sich erste Zweifler, kommt sie, kommt sie nicht, kommt sie zu spät. Nein: Unsere Fontane-Briefmarke für das 2019er Jahr, sie ist da. Der Initiative der Stadt Neuruppin hatte sich auch die Theodor Fontane Gesellschaft sogleich angeschlossen und werbend mit ins Zeug gelegt. Das Bundesfinanzministerium ließ sich gewinnen und gab dem Ganzen das nötige Format. Alle, die ihre Post bisher eisern zurückgehalten haben, um endlich mit diesem Sonderwertzeichen die Fracht zu frankieren, sie können aufatmen. Ein großer Tag ist in die Annalen der Sonderpostwertzeichen einzutragen – und Sie können sagen: „Wir sind dabei gewesen“.
Wenn es jemanden gegeben hat, dem eine solche Ehre gebührt, dann Theodor Fontane. Was für ein Briefschreiber vor dem Herrn! Wo andere nach getaner Arbeit die Beine hochlegen und den lieben Herr Gott einen guten Mann sein lassen, rückte er das Tintenfass zurecht, tunkte die Feder tief ein und beglückte die Welt mit epistolographischen Diamanten. „Andere spielten Domino, züchteten Rosen, hörten Musik oder verführten Mädchen“, so der unvergessene Marcel Reich-Ranicki, „[e]r aber schrieb Briefe, Hunderte, Tausende“. Wir sagen heute: Wahrscheinlich waren es etwa elftausend. Davon kennen wir circa die Hälfte.
Erhalten sind Ausschnitte des lebenslangen und umfangreichen Briefwechsels mit seiner Frau Emilie (knapp 600 dieser Briefe sind überliefert und von den Gegenbriefe 180), der intensive Gedankenaustausch mit Tochter Martha bildet einen weiteren bedeutenden Teil seiner erhaltenen Korrespondenz. Gleiches gilt für Freundesbriefe wie denen an Bernhard von Lepel. Es gibt umfangreiche Briefschaften mit Verlegern und Redakteuren. Kein Rezensent, der ein Wort zu seinen Büchern veröffentlichte, blieb von Fontane unbedankt. Die Briefe sind Zeugnisse von Ideen- und Alltagsgeschichte, zeichnen in Gesellschafts- und Kulturkritik ein Epochenbild. Sie reflektieren eigene wie fremde literarische Produktion und sind Spiegel ästhetischer wie kulturell-politischer Diskussionen ‒ außerdem sind sie, fast ihr Bestes, im höchsten Grade unterhaltsam!
Denn in meinem eigensten Herzen bin ich geradezu Briefschwärmer und ziehe sie, weil des Menschen Eigenstes und Ächtestes gebend, jedem andern historischen Stoff vor. All meine geschichtliche Schreiberei, auch in den Kriegsbüchern, stützt sich im Besten und Wesentlichen immer auf Briefe.
Das gestand Fontane Hanns Fechner am 3. Mai 1889. Er selbst nannte sich den „Mann der langen Briefe“ (an Karl Zöllner, 13. Juli 1881), Postalisch zu reagieren, das sei seine „einzige[] absolute[] Promptheit“, er fand sich und uns das Wort „Briefbeantwortungspromptheit“ (an F. Stephany, 18. Juni 1884). Er schreibe, musste er einmal gestehen, „so viel, daß ich hinterher nie mehr weiß was in diesem oder jenem Briefe gestanden“ (an Emilie Fontane, 17. August 1882) habe.
Wer Briefschreibtalent hatte, hatte bei Fontane seinen Bonus weg und ein Kredit auf Dauer. Der Brief erlaubte alles, sein Kriterium war ihm nicht die Länge, sondern die Unterhaltsamkeit. Er stellte Ansprüche. So etwa im Februar 1857 gegenüber seiner Frau Emilie. Er bleibe dabei, „das Du im Allgemeinen Deine Briefe mit etwas mehr Rücksicht auf meine Person schreiben […] könntest“. Oder: „So sehr liebenswürdig Dein Brief ist, so enthält er eigentlich nichts worauf ich zu antworten hätte“ (10. März 1857). Fontane ging, war das Paar getrennt, soweit, seine Frau zu instruieren, wann sie wieder und in welchem Rhythmus ihm zu schreiben habe – ob lang, wie detailliert und, dies vor allem, recht heiter und frei aller Klagerei. „[M]orgen erwarte ich einen etwas längren Brief, bin aber nicht böse, wenn er ausbleibt. Denn wenn man nicht eine Schreibepassion hat oder das Unterhaltungsbedürfnis der Einsamkeit, so darf man sich füglich fragen: ‚ja, was schreiben?‘“ (an Emilie Fontane, 21. Juli 1883). Als ihm Julius Rodenberg Februar 1880 einen ebenso liebenswürdigen wie vertrauensvollen und langen Brief schickte, sprach Fontane in seinem Dank von einer „wahre[n] Liebesthat“. Mit Briefen hielt man sich auf dem Laufenden, und auf dem Laufenden wollte Fontane gerne sein: familiär wie beruflich, literarisch wie in Weltbelangen.
Briefe waren ihm auch Dokumentarisches. Sie besaßen Zeugniskraft, waren gewissermaßen justiziabel, waren ein Heikles, ein Etwas, das zu Vorsicht riet und Achtsamkeit gebot. „Laß keine Briefe umherliegen, weder solche die Du schreibst“, mahnte er seine Tochter Martha, „noch solche die Du empfängst. Solche, die einem irgendwie Verlegenheit schaffen können, muß man gleich verbrennen oder in kleine Stücke zerreißen.“ (4. August 1880) Es gab Antwortbriefe, Geldbriefe, Scheidebriefe, Frachtbriefe, Osterbrief, unterhaltliche und natürliche etc. pp.
Fontane war es in zunehmendem Maße Gewissheit: Briefschreiben stand in geschwisterlicher Verbindung zum Erzählen. „Die kleinen Pensionsmädchen haben gar so unrecht nicht, wenn sie bei Briefen und Aufsätzen alle Heiligen anrufen: ‚wenn ich nur erst den Anfang hätte.‘“ (an Gustav Karpeles, 18. August 1880) Die Anspruchslatte wurde hochgelegt. Wer sie nehmen wollte, musste sich strecken. Auf Einvernehmlichkeit hin ließ Fontane gegenüber dem Komponisten und Erzähler Hermann Wichmann fallen, „daß Personen wie wir doch nicht bloss […] Gratulations- und Anstands-Briefe mit einem Nichts von Inhalt zu wechseln haben, sondern dass ein solcher 10 Seiten langer Brief mit einer Fülle von Lokal- und Menschen-Schilderung, auch als ein ‚Manuskript‘, als eine kleine literarische Arbeit angesehen sein will.“ (2. Juni 1881)
Dafür war in Ruhe Tee auf den Tisch zu stellen, die Gänsefeder zu prüfen und ein kleiner Papierstapel zurechtzulegen. Nichts, was zwischen Tür und Angel zu erledigen war, auf seine Weise ein heiliges, jedenfalls ein heilsames und heilstiftendes Geschäft: ohne dass es mit Pauken und Trompeten daherkam. Wer daran ging, „den Briefberg oder die Briefschuld abzutragen“ (an Martha Fontane, 3. Juni 1881), tat gut daran, sich der rechten Umstände zu vergewissern. Was Fontane aus dem Postkasten nahm, es wurde in der Regel benotet: brillant, liebenswürdig, hübsch, nett, relativ wichtig oder eben unbedeutend. Eigenes eingeschlossen, auch in der Kritik. „Ich habe heute Nachtmittag nicht geschlafen, drum ist der Brief etwas holprig.“ (an Emilie Fontane, 25. Juni 1881). Hier schnell noch das höchste zu vergebene Lob: „Von Mama hatte ich gestern einen langen Brief, acht Seiten, was glaub ich in unsrer langen Ehe keine 4 mal vorgekommen ist. Sie hat eine reizende Art zu schreiben, eine Mischung von Natürlichkeit, Unwissenschaftlichkeit und leiser Ironie theils über sich theils über die ‚Wissenschaftlichkeit‘“ (an Martha Fontane, 4. August 1883).
Und klar war ihm auch. Zum Brief oder der Postkarte gehörte ihr verlässlicher Transport, das stimmige „Couvertiren“. Das Frankieren galt es zu regeln, ob unter Kreuzband oder nicht, Rohrpost oder Bote. Das Postwesen hat in Fontanes Jahrhundert enorme Veränderung erfahren. Seit Mitte der zwanziger Jahre gab es in Preußen Briefkästen, in die zu jedem Zeitpunkt adressierte riefe eingeworfen werden konnten. Hausbriefkästen allerdings blieben lang die Ausnahme, und der Postbote kam persönlich an die Tür. Und er wusste nicht selten auch, unvollständig adressierte Schreiben an den rechten Ort zu bringen. „Sicherheitshalber laß ich sie (diese Zeilen) den Weg über Berlin nehmen, denn ein Berliner Briefbote weiß alles und dirigirt alles richtig.“ (an Emilie Zöllner, [20.8.1880])
Briefe waren bis weit ins 19. Jahrhundert noch nicht einer klaren Norm unterworfen, gefaltete Bögen, die den Text auf der Innenseite und außen Schnürung oder Sigel aufwiesen, die Regel. Erst seit 1840 wurden Briefumschläge maschinell hergestellt. Bevor im Jahr 1850 Briefmarken das Postwesen eroberten, war es üblich, dass der Empfänger das Briefporto zahlte. Nicht nur die Möglichkeiten der schriftlichen Kommunikation erweiterten sich ‒ die Berliner Rohrpost eröffnete 1865 ihre erste Strecke (so folgenreich, dass das Bundeskanzleramt sich bis heute noch dieser Praxis bedient) und die Erfolgsgeschichte der Postkarte begann 1870. Auch die Geschwindigkeit der Briefzustellung gewann im 19. Jahrhundert rasant an Tempo. Im Roman Frau Jenny Treibel bedankt sich Marcell Wedderkopp bei Professor Schmidt für dessen verbindliche Protektion ‒ und für den Modus der Benachrichtigung:
Der Brief an Marcell, ein Rohrpostbrief, zu dem sich Schmidt nach einigem Zögern entschlossen hatte, war seit wenigstens einer halben Stunde fort, und wenn alles gut ging und Marcell zu Hause war, so las er vielleicht in diesem Augenblicke schon die drei lapidaren Zeilen, aus denen er seinen Sieg entnehmen konnte. […] und alles in allem ließ sich annehmen, daß Marcell binnen kürzester Frist erscheinen würde, seinen Dank auszusprechen. Und wirklich, fünf Uhr war noch nicht heran, als die Klingel ging und Marcell eintrat. […] „[…] Aber daß Du mir‘s gleich geschrieben, […]. Und noch dazu mit Rohrpost!“ „Ja, Marcell, das mit Rohrpost, das hat vielleicht Anspruch; denn eh‘ wir Alten uns zu ‘was Neuem bequemen, das dreißig Pfennig kostet, da kann mitunter viel Wasser die Spree ‘runterfließen.
Schnelligkeit zeichnete aber nicht allein die neue Rohrpost aus. Stellte sich etwa bei Fontane am Morgen ein unleidlicher Infekt ein, wusste der Rütli-Freundeskreis schon am frühen Nachmittag, dass er ohne ihn zu tagen hatte. Bis zu fünfmal täglich klingelte der Postbote in Berlin, was ihm zuweilen mit einem Schnäppsken gelohnt wurde ….
Wollte Fontane heute nur die Post verschicken, von der wir ungefähr wissen, müsste er ‒ vorausgesetzt, alles hätte Standardmaß und bliebe auf das Inland beschränkt ‒ weit über 9.000 € hinlegen. Klagen über Portohöhe sind nichts Neues. Schon die Tarife der königlichen Stadtpost, die in Berlin 1827 etabliert worden war, boten reichlich Anlass. Kein Wunder, dass das Haushaltsbuch der Fontanes akribisch alle Portoausgaben verzeichnete.
Briefe, die eigenen und die der anderen, hatten nicht nur ihren Preis, sondern auch ihren Wert – und sie waren es Fontane wert, aufbewahrt zu werden. „Vielleicht empföhle es sich, für solche Skripturen eine eigene Mappe anzuschaffen.“ (an Emilie Fontane, 17. Juni 1884) Fontane begann damit früh. Er sammelte, was ihm an Briefschaften ins Haus kam, und war darauf bedacht, dass nicht verloren ging. Je mehr Jahre ins Land gingen, umso sorgsamer. Gleiches galt für seine Familie. Man sandte sich Post nach, legte Korrespondenzen an, ganze Briefpakte wurden verschickt. Nicht zufällig, dass das Wort vom „Briefnetz“ sich einstellte und festhakte. Dem lieben Literaturgott sei gedankt, dass der Fontane-Brief in jeder Gestalt sein Daseinsrecht zu verteidigen wusste. Ihm zur Ehre, uns zur Freude.
Wer, wie Fontane, ein Meister in dieser Schreib- und Ausdrucksform war, der nutzte deren Kraft auch literarisch. Kein Roman, keine Novelle aus seiner Schreibwerkstatt, die sich nicht des „Briefes“ bediente, um dem Erzählen eine ganz eigene Note zu verleihen. Bereiten Sie sich die Freude – und wir versprechen: es wird eine Freude! – und sieben Sie aus Fontanes Erzählwerk alle Briefe, die dort Eingang fanden. Und Sie werden staunen. Es sind nicht selten entscheidende Momente der Geschichten, in denen die Figuren zur Feder greifen, um dem Ganzen noch einmal eine entscheidende Wendung zu verpassen. Nicht nur einmal hat ein Brief sogar das letzte Wort im Roman: Denken wir nur an das Schreiben von Hofprediger Dörffel in Cécile oder an das der seelenschönen Victoire, deren lebensklugen Zeilen an Freundin Lisette von Perbandt das komplette letzte Kapitel in Schach von Wuthenow füllen. Und Botho von Rienäcker weiß jenen Schreibzauber zu würdigen, wenn er aus der brieflichen die lebendige Gestalt seiner Lene in Irrungen, Wirrungen herausspürt. Hören wir nur kurz hinein:
Wie gut sie schreibt! Kalligraphisch gewiß und orthographisch beinah … […] Und ›emphelen‹. Soll ich wegen f und h mit ihr zürnen? Großer Gott, wer kann ‚empfehlen‘ richtig schreiben? Die ganz jungen Komtessen nicht immer und die ganz alten nie. Also was schadt‘s! Wahrhaftig, der Brief ist wie Lene selber, gut, treu, zuverlässig, und die Fehler machen ihn nur noch reizender.
Magie ist im Spiel, wenn ein Brief seine Rolle übernimmt. Was um alles in der Welt ließ die arme Effi die vermaledeiten Crampas-Briefe aufheben, weiß doch schon die gute Frau Zwicker: „Es ist unglaublich – erst selber Zettel und Briefe schreiben und dann auch noch die des anderen aufbewahren! Wozu gibt es Öfen und Kamine?“ Kurzum: Wenn Sie den Lesespaß auf die Spitze treiben wollen, filtern Sie alle diese Briefpartien aus dem Romanwerk heraus und sehen Sie zu, was übrigbliebe ‒ wenig, ach, weniger als nichts!
Es gilt ein Sonderwertzeichen zu feiern, und wir tun das gerne. Die Post, meine Damen und Herren, wünscht sich, dass Sie in den nächsten Monaten reichlich Umschläge mit 1,55 € frankieren, so etwa einmal in der Woche. Wir indes wünschen uns, dass Sie auch fortan zu der großen Gemeinde der Fontane-Leserinnen und –Leser gehören: und das täglich!“