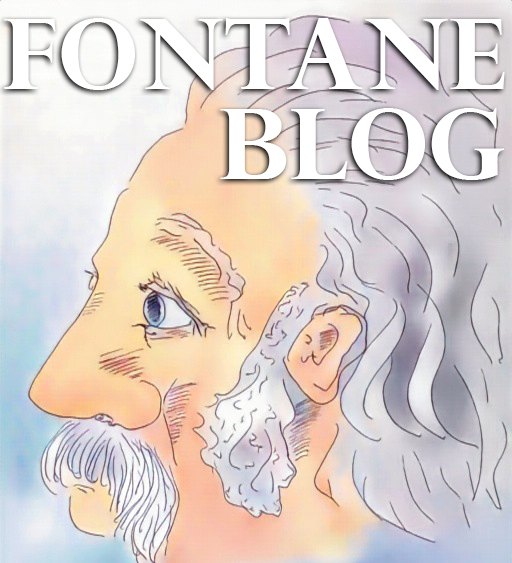Meine sehr verehrten Damen und Herren,
war es wirklich vor zwölf Monaten, dass wir hier am selben Ort mit leuchtenden Augen standen, uns ansahen, lächelten und sagten: „was für ein Jahr, unser Fontane-Jahr!“? Zuversichtlich ging der Blick ins neue Jahr. Als wir hinüber in die Kulturkirche gingen, um ein bisschen weiter zu feiern, hatten wir keinerlei Zweifel, dass die blitzblanken Gleise, die Jubiläum gelegt hatte, unseren fröhlich-dampfenden Fontanezug auch ähnlich glatt durch das 2020-er geleiten würden. Wir drückten einander, schüttelten die Hände und klopften unsere Schultern, Fontane.200 hatte uns aufs Schönste vereint, eine Gemeinschaft unter seinem Namen und ganz in seinem Sinne.
Doch mit Jahresbeginn zogen Wolken auf, dunkel – und bald derart bedrohlich, dass uns die Begriffe verloren gingen und mit ihnen Vergleiche. So etwas hatten wir noch nicht erlebt. Corona und Covid19 legten sich über unser aller Tun. Die wir eben noch im beseelten Fontane-Rausch waren und mit einem lustigen Kater danach rechneten, versanken in Katzenjammer. Der Kulturbetrieb, dessen Räderwerk gerade noch so schön gesurrt hatte, kam in einem Tempo zum Erliegen. Fassungslos standen wir daneben. Wir rieben uns die Augen. War, was gestern eine licht-helle Fontane-Welt war, wirklich gewesen? Als Ihr Bürgermeister Jens-Peter Golde sein 65. Lebensjahr vollendete und sich schon auf einer Safari-Tour durch Europa sah, zeichnete ich ihm etwas: Das Bildchen zeigte ihn mit goldener Kette an seinen Stadtheiligen Fontane gebunden. Aber die Zeichnung war falsch, oder doch anachronistisch. Schon dass ich sie dem Geburtstagskind nur per E-Mail-Anhang zukommen lassen konnte, hatte Signalwert. Statt Fontane nämlich wäre jenes Monstergebilde zu zeichnen gewesen, das wir fortan Abend für Abend in den Fernseh-Sondersendungen anschauen musste, und statt der goldenen hätte eine bleiern-brutale Kette gehört. Aller Glanz von gestern – heute stumpf.
Sie nicken, meine Damen und Herren, es fällt Ihnen so schwer wie mir dieser Auftakt. Sie tragen Mundschutz, der Abstand zwischen Ihnen beträgt 1 Meter 50, die Hände sind gewaschen – und gleich nach Heimkehr werden sie erneut abgeschrubbt.
Schlechte Zeiten für Fontane?
Vielleicht denken Sie das. Doch ich denke gar nicht daran, wie Sie zu denken. Wo kämen wir da hin – und wo gar der Vorsitzende einer literarischen Gesellschaft, die es mit Fontane hält, unter allen Umständen und allzeit: ein fortlaufendes Gespräch aus unserer Gegenwart in seine Vergangenheit und zurück in dieses Jetzt! Hat er, höre ich fragen, denn überhaupt etwas zu Pandemien, zu Viren oder Epidemien gesagt? Natürlich. Etwa in seinen Erinnerungen Meine Kinderjahre: „Herbst 31 sah sich die Revolution besiegt, aber ein neuer schlimmerer Feind war inzwischen heraufgestiegen und näherte sich von Osten her unsern Grenzen: die Cholera. Vorbereitungen zur Abwehr derselben wurden getroffen, natürlich (wie immer) auch bewitzelt […]“. Unser Bewitzeln hält sich, auf schwerem Grund, in Grenzen, aber unterkriegen lassen wir uns so wenig wie jene Swinemünder damals. Brachte man dort jedoch Kanonen als Grenzwall in Stellung, ziehen wir Hoffen vor – und die größte Hoffnung, sie richtet sich auf einen Impfstoff als Heilsbringer.
Aber noch ein bisschen geblättert: Als Fontane den Krieg 1866 zwischen Dänemark und Preußen schilderte, konnte er seinen Schrecken nicht verhehlen, als er erfuhr, dass es während dieser militärischen Kämpfe mehr Tote durch Cholera und Typhus gegeben habe als durch Gewehr, Pistole und Säbel. Typhus. Vom Typhus – seinerzeit eine durch Bakterien im Trinkwasser rasend schnell um sich greifende, aggressiv ansteckende Erkrankung – hatte Fontane früh selbst einen Begriff bekommen. 1841 erwischte sie ihn, er laborierte lange daran und bedurfte der elterlichen Pflege in Letschin, um wieder auf die Beine zu kommen. Er war sensibilisiert und blieb es fortan. Im zweiten Erinnerungsband Von Zwanzig bis Dreißig schaute Fontane zurück auf das Jahr 1840 und jene kühnen Absichten, die Desinfizierung der Themse soweit voranzutreiben, so dass „alle Lästigkeiten und Fährlichkeiten bei Cholera und ähnlichen Epidemien […] ein für allemal beseitigt“ wären.
Ungläubig. Sein pharmazeutischer Sinn war zu ausgeprägt, um an den Erfolg solcher übermütigen Vorhaben zu glauben. Immer wieder sahen er wie seine Zeitgenossen sich konfrontiert mit explosiv ausbrechenden, unberechenbaren Seuchen. Die Wissenschaft, weit entfernt, dem gewachsen zu sein, drohte zu kapitulieren. Noch ahnte man nicht, was da den Tod brachte. 1864 bekam Fontane einen Brief von seinem ehemaligen Tunnel-Gefährten Paul Heyse. Der schrieb von einer „böse[n] Epidemie, die unsere Stadt in ein Lazarett verwandelte“. Gemeint war München, aber es hätte Gültigkeit gehabt für alle Großstädte. 1892 – um ein letztes Beispiel zu geben – las Fontane mit Erschütterung und Schrecken, wie Hamburg von einer Cholera-Epidemie erfasst und innerhalb sechs Wochen zur Grabstätte von beinahe 10.000 Menschen wurde. Lockdown: Fontane hätte das Wort verstanden, sein Englisch war gut – „Ausgangssperre“. Hätte er sich vorstellen können, wovor uns dieses Wort gestellt hat, welche Erfahrung es uns brachte? Kaum. Doch dürften keine ernstlichen Zweifel sich regen, dass er das Verständige an der Sache gesehen und aus dem Misslichen das Beste für sich gemacht hätte. Vielleicht wäre der sich immer wieder regende Gedanke, aus der Millionenstadt Berlin aufs Land zu ziehen, in die Tat umgesetzt worden. Mag sein, dass er sich mit Emilie ins Riesengebirge verpflanzt hätte oder zur Tochter nach Waren, nicht ganz glücklich, aber auch nicht unglücklich.
Stoff zum Räsonieren hätte ihm das, was wir seit Monaten täglich erleben und dessen Ende wir herbeisehnen, reichlich gegeben. Die Zeitungen wären gewiss bereit gewesen, seine Beobachtungen zu drucken – und vielleicht hätte die Kontroversen ausgelöst. Lassen wir das, weil es übers Vermuten nicht hinausgeht, dahingestellt sein.
Das wenige, was ich angedeutet habe, darf Sie getrost locken, auch unter Coronas Ägide Ihren „Fontane“ in die Hand zu nehmen. Wie liest er sich, der sich doch so gut bei anderen Gelegenheiten gelesen hat? Zieht die Bangnis vor dem Virus neue Lesespuren, erlaubt sie, bislang Unentdecktes freizulegen? Was aus dem breitgefächerten Werk empfiehlt sich jetzt, gerade und ausgerechnet jetzt? Die Wanderungen, Effi oder Der Stechlin? Die Feuilletons, die Theaterbesprechungen? Ja, die möglicherweise, weil sie uns in einen Kunstraum mitnehmen, den wieder zu betreten, wir so sehr wünschen. Aber es kann auch sein, dass ganz andere Texte in den Blick geraten – und dass Sie plötzlich einen neuen Fontane antreffen. Er erinnert Sie an den alten, aber doch nicht ganz, er klingt wie der, aber doch anders. Endlich werden Sie, da bin ich fast gewiss und siegessicher, einen der Briefbände in die Hand bekommen. Ist es der mit den Briefen an Georg Friedlaender, dann kann es sein, dass Sie den vom 3. Juli 1887 aufschlagen. Ihr Blick bleibt hängen, weil Ihnen im Text eines der Unwörter des Jahres 2020 ins Auge sticht. So sehen Sie genauer hin und lesen:
[…] Früher wurden Dinge ‚Mode’, die nur der eine mitmachte der andre nicht, jetzt fasst ein Schlagwort oder gar eine ‚Parole’ die Menschen mit der Macht einer Epidemie, der sich der Einzelne kaum entziehen kann und die so lange dauert bis ein bestimmter Theil der Gesellschaft ‚ausgeseucht’ ist. Aber schon ist eine neue Epidemie da und bemächtigt sich eines neuen Bruchtheils der Gesellschaft. […]
Und stehen Sie mit Fontane auf vertrauterem Fuße, was ich mir gut denken kann, dann werden Sie lächeln und murmeln: „Na, lieber Alter, auf Dich ist Verlass. Wusst‘ ich’s doch …“.
Meine sehr verehrten Damen, Fontane sei Ihnen ans Herz gelegt, und meine verehrten Herren, proben Sie die Rolle eines Fontane-Vorlesers – und gehen Sie alle mit Zuversicht in das neue Jahr. Es wird, denke ich, auch wieder ein Fontane-Jahr.
In diesem Sinne die besten Wünsche Ihnen: auf ein Ende der Corona-Ära und wieder und wieder ein Anfangen mit Fontane!