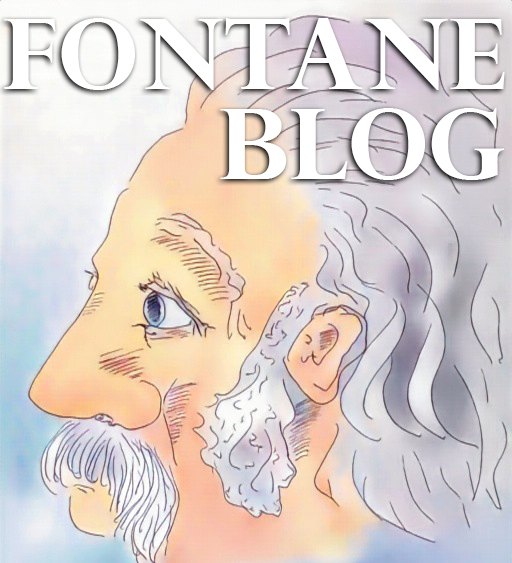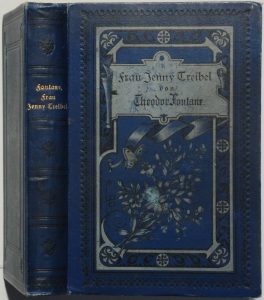
Ein ganzer Roman – und damit letztlich auch der Ruf des Autors – hat darunter zu leiden, dass er so scheinbar unverbindlich endet, ausgeht wie ein seichtes Bühnenstück und deshalb auch so angesehen wird: Zahlreich sind inzwischen die Belege, die den Roman Frau Jenny Treibel als „Lustspiel“ abtun, als „Komödie“ bezeichnen.
Das ist zwar aus beträchtlicher Entfernung hergeholt in übertragene Bedeutung, denn selbstverständlich ist der Zeitvertreib von 1892 ein „Erzählwerk“, kein Drama, doch es gilt ganz anerkanntermaßen, beispielsweise im „Fontane-Handbuch“, als das „relativistischste Erzählwerk Fontanes“. Und unter dem von ihm geborgten Stichwort „Heiteres Darüberstehen“ haben etliche auch seinen Verfasser eines erheblichen Relativismus geziehen, mit dem meisten Widerhall wohl Georg Lukács, der als Fontanes „Lebensprinzip […] verzeihendes Zur-Kenntnis-Nehmen von Lebenstatsachen der herrschenden Klassen [ansah], gegen die der Stoff selbst ein härteres Auftreten fordert“.
So wie der Narr in Shakespeares Was Ihr wollt die Zuschauer am Schluss nach Hause schickt, so endet der Roman mit einem närrischen Gymnasialprofessor Schmidt, der alle abgehandelten Probleme der Erzählung zum Ende einer Hochzeitsfeier gegen Null relativiert:
Geld ist Unsinn, Wissenschaft ist Unsinn, alles ist Unsinn. Professor auch. Wer es bestreitet, ist ein pecus. Nicht wahr, Kuh… Kommen Sie, meine Herren, komm, Krola… Wir wollen nach Hause gehen.
Zwar wissen wir, dass auch das Ende eines Stückes kein Appell ist, den sich der Betrachter mit Gewinn hinter die Ohren schreiben soll. Wenn Meister Anton einsieht, dass er, wie sie ist, die Welt nicht mehr verstehe, dann lernen wir daraus womöglich dennoch allerhand.
Keine Komödie, doch komödien-haft ist der Roman, von allen des Verfassers übrigens der einzige mit einem „happy ending“, auch in seiner Darbietungsweise: Es ist der mit dem größten Anteil an Dialogen, also mit dramatischer Redeform. Sie machen gezählte 70 % des gesamten Romans aus. Die Hälfte davon, grob geschätzt, ist innerhalb der Handlung small talk. Vom Leser aus betrachtet, konstituieren Sie jene „tausend Finessen“, die der Dichter nicht bloß für Irrungen, Wirrungen beansprucht hat.
Und was den Schluss der Erzählung betrifft, der aus knappesten auktorialen Erzählerberichten besteht, als solle, wenn auch spät genug, die Frage nach dem Genre des Romans noch ein für alle Mal entschieden werden, so sollten wir nicht übersehen, dass sie Erhebliches getrunken haben. Ob Trarbacher oder Chablis, wie bei Gelegenheiten im Roman, wird nicht verraten, doch Champagner steht bereit, und die knappe Erzählung verrät über ihre letzte Geselligkeit nur, dass „an Toasten kein Mangel“ war, also auch nicht am Prost!
An des Professors schon zitierter Generalabrechnung mit den anerkannten Werten fällt auf, dass er endlich alle schwankend duzt, und für Treibel denkt sich der Erzähler gar eine Sonderform der „Erlebten Rede“ aus, die ausnahmsweise nicht die Figurenrede der Erzählerrede ähnlich macht, sondern den Erzähler reden lässt, als sei er die Figur: Treibel, heißt es da, „saß neben seinem Bruder Schmidt“. Der Erzähler weiß, dass sie nicht Brüder sind.
Nur für den nüchtern gebliebenen Leser gibt der Verfasser noch ein intrikates kleines Bömbchen mit: Wer seine Weltansicht bestreite, die Trinität des Unsinns: „Geld“, Wissenschaft“, „Professor“, so der Lateinprofessor Schmidt, der „ist ein pecus“, also ein „Vieh“ oder ein „Ochse“. Und er lässt sich das Urteil, ausgerechnet, vom Kollegen Kuh bestätigen, den er in der Menge mit dem Namen ruft. Nicht zu vergessen, dass es am „Großen Kurfürsten-Gymnasium“ auch noch den „Professor Rindfleisch“ gibt.
„Was will uns der Dichter sagen? Mit dieser blöden Frage fängt es an.“ – So hat Hans Magnus Enzensberger es gesagt, mehrfach, zuletzt 2004 in seinem Büchlein „Lyrik nervt“. Er zeigt Erbarmen mit dem Verdächtigen. „Dabei hat der arme Dichter doch schon gesagt, was er sagen wollte; wahrscheinlich will er einfach nur beim Wort genommen werden.“
Ich möchte hier nichts anderes tun, als jenes wunderbare Werk in diesem Sinn beim Wort zu nehmen. Jenen Roman, der immer noch ein wenig in Verruf ist, seit Georg Lukács (1951) seinetwegen die Nase gerümpft hat, er sei bei aller satirischen Kraft doch allzu nah „der bloßen Belletristik“. Das, angesichts Fontanes, klingt ein wenig hart. So widerruft der strenge Richter: „Stilistisch kultivierte Belletristik“.
Fontane hielt zwar nachdrücklich dafür, in diesem ungemein Pläsierlichen, wohl je nach Standpunkt auch Satirischen von Jenny Treibel sei der Zweck des Buchs noch nicht erschöpft. Er habe vielmehr hier „das Hohle, Phrasenhafte, Lügnerische“ usw. „des Bourgeoisstandpunktes“ zeigen wollen. Wäre das denn nicht Verdienst genug? Und wer behauptet, dass ihm das misslungen sei? Selbst Lukács wusste: „Der alte Fontane ist ein sehr bewusster Künstler.“ Hätte er das doch geglaubt!
Gewiss, von dem frühen Motto des Kollegen Herwegh, „Partei, Partei, wer sollte sie nicht nehmen?“, hatte der Alte längst Abschied genommen, seitdem er sich 1848 noch im Brief an Freund Lepel gewandt hatte: „Mit dürren Worten: hast Du nicht auf väterlicher Rumpelkammer eine alte aber gute Büchse?“ Parteinahme: Das fand er nur noch öde. Doch Georg Lukács wünschte sich weit mehr Entschiedenheit, ein wenig mehr vom Geist der „Klassenkämpfe“ jener Zeit, nicht bloß Satire, sondern ‚Rebellion‘. Fortschritt, der „uns weiterbringt“, das Kriterium der neuen Zeit, in Wirklichkeit, nicht auf Papier. Ein Revolutionär nach Lukács‘ Wünschen ginge nicht nach Hause. Er bliese zur Revolte.
Er ließ den Daumen also sinken. Und niemand sagte etwas zur Verteidigung. Zum Beispiel bloß: Was spricht denn gegen Belletristik? So schnell und leicht indessen wollen wir noch nicht die Waffen strecken! Stellen wir sie also, Hans Magnus Enzensbergers „blöde Frage“, die er nur zitiert: „Was will uns der Dichter sagen?“ Und wenn er uns das nicht verraten will? Oder selbst gar nicht weiß? Dann nehmen wir mit dem vorlieb, was er uns sagt. Und wie er es uns sagt. Das sollte nach dem Anfang klar geworden sein. Mit einem Wort: Was er erzählt. Mehr braucht es nicht.
Mehrfach, jüngst 2004 in seinem Büchlein „Lyrik nervt“, hat Enzensberger uns gesteckt, worauf es ankommt. Der arme Dichter, so der Dichter Enzensberger, habe schon gesagt, was er zu sagen hatte. „Wahrscheinlich will er einfach nur beim Wort genommen werden.“ Also wollen wir einmal den heitersten Roman Fontanes bis zuletzt bei allen Wörtern packen, die er sagt, vielleicht auch, die man deshalb über ihn gesagt hat. Zum Beispiel, für die erste Klärung, den berühmten Satz von Katharina Mommsen, der großen alten Dame der Goethe-Philologie, der mit Pathos anhebt: „Noch in seinem letztem Roman ‚Der Stechlin‘ ruft Fontane den Preußen zu…“. Hier stock‘ ich schon, wer hilft mir weiter fort? Wer den Roman kennt, ja, selbst wer ihn nicht kennt, weiß: Fontane könnte hier nicht rufen, und „zurufen“ schon gar nicht. Er kommt in dem Roman nicht vor, er ist der Autor. Er guckt von außen und kann sich daher „äußern“ zum Roman, eingreifen in ihn kann er nicht.
Als Autor steht er da wie auch der Leser, auch wie der Betrachter, wenn wir an ein Drama denken. Die kommunikative Grundannahme jedes Stücks, dass nämlich im Theater ein Geschehen nicht erzählt wird, sondern sich im Augenblick vor uns ereignet, zugegeben, zwischen Schauspielern wie wirklich zwischen Gegenspielern: Diese Grundannahme sieht nicht vor, dass einer sich dabei dem Publikum zuwendet, und wenn dann doch, dann als ein Bruch der Konvention wie der Erzähler im Roman, der Clown bei Shakespeare oder der Sänger bei Brecht.
Stattdessen wendet nach der Grundannahme sich das ganze Stück, auch der Roman als Ganzes, mit allen ihren Stimmen unterschiedslos dem Betrachter zu, dem Hörer oder Leser. Das mag, wer will, dann metaphorisch „Rufen“ nennen. Die Frage nach der Bühnenform, die diesem kommunikativen Schema angemessen ist, hat sich seit den Stücken der Antike in schöner Analogie immer wieder neu in Theaterbauten gespiegelt, die, aller Unterschiedlichkeit zum Trotz, streng bauliche Entsprechungen zu dem je typischen Modell der Überlagerung der beiden Kommunikationssysteme bedeuten.
Dieses Modell, das Manfred Pfister seiner Systematik des Dramas zugrundelegt, geht, wie bereits angedeutet, aus von der Konstituierung zweier separater Kommunikationssysteme: 1. Dem „inneren“ auf der Bühne (der Geschehensebene) und 2. dem dieses überlagernde „äußere“ der eigentlichen „literarischen“ Kommunikation zwischen dem „Literaten“ und dem Rezipienten. Diese Überlagerung bringt es mit sich, dass jegliche Replik im Drama zwei Urheber hat und auch zwei Adressaten, (a) den Autor und sein Personal sowie (b) dessen Gegenüber im Stück und den/die Rezipienten auf den Rängen.
Informationstheoretisch betrachtet, bedeutet das im Normalfall, dass mit der Zeit der Grad der Informiertheit beim Rezipienten im äußeren System umfangreicher wird als der einer Figur im inneren.
Es liegt auf der Hand, dass in erzählenden Texten, denen die dramatische Unmittelbarkeit der Figurenhandlung oder -rede fehlt, noch ein vermittelndes Moment hinzuzusetzen ist, das System des Erzählers. Fontane also, kann nicht rufen „im Roman“, er könnte es, metaphorisch nur, „mit dem Roman“. Er ist es, der Kuh „Kuh“ nennt, Schmidt weiß, dass der Kollege so heißt, aber ob er weiß, dass er – im „inneren“ System, in diesem Augenblick ein Wortspiel spielt mit dem berufsbekannten „Pecus“: Das weiß der Leser – im „äußeren“ – nicht. Dafür weiß er um das Wortspiel. Die sogenannte „diskrepante Informiertheit“ zwischen den Systemen bedingt bei jedwedem darstellenden oder erzählenden Werk einen doppelten Boden, randvoll mit mannigfachen ästhetischen Wirkungen.
Bleiben wir beim Thema, den „Namen im Roman“ und trennen wir mit Sorgfalt jene Seinsbereiche, die zu trennen sind: So finden wir wohl viel von dem, was Lukacs abtat als „stilistisch kultivierte Belletristik“. Demgegenüber möchte ich zeigen, dass auch das Konzept der Namen, konsequenter angewendet, dazu beiträgt, das kritische Potenzial des Romans zu schärfen und nicht bloß der vermeintlichen ‚relativistischen‘ „Komödie“ ein paar Lacher zu bescheren.
Natürlich sind die vielen kuriosen Namen im Roman noch niemals unbemerkt geblieben: Die durch ihre Heirat wohlhabend sowie Kommerzienrätin gewordene Jenny Treibel hieß als Kind noch „Bürstenbinder“ und entstammte der nämlichen Schicht. In ihrem Umfeld heute lebt ein „Fräulein Honig“, das bereits im ersten Kapitel eingeführt wird als versehen mit „sauer-süßer Miene“; und ebenfalls im ersten Kapitel spricht Jenny von einem Besucher, einem Mr. Nelson, der es schafft, mit einem einzigen – dabei noch falsch bezogenen – Zitat seines Namensvetters Gespräche zu bestreiten, ein „Sohn von Nelson & Co.“ – als könne eine Handelsgesellschaft Kinder zeugen.
Die groteske Konjunktion des Unvereinbaren in ihrer Sprache setzt Jenny wiederholt dem Spott der Leser aus, etwa wenn sie davon spricht, „dem Holzhof […] Honneurs“ zu machen. Anlässlich einer Tischgesellschaft bald darauf ahnt sogar der begriffsstutzigste Leser, wie hier mit den Namen Spott befördert werden soll – weil es nämlich der begriffsstutzigste Vertreter der Gesellschaft im Roman erkennt, ein Leutnant Vogelsang, den Nelson wenig später aus Versehen „Sangevogel“ nennt: Treibel weist den Leutnant auf zwei Damen und auf zwei Besonderheiten hin
„[…] die korpulente: Frau Majorin von Ziegenhals, die nicht korpulente (worin Sie mir zustimmen werden): Fräulein Edwine von Bomst.“ – „Merkwürdig,“ sagte Vogelsang. „Ich würde, die Wahrheit zu gestehen…“ – »Eine Vertauschung der Namen für angezeigt gehalten haben. Da treffen Sie’s, Vogelsang […].“
Kuriose Namen kommen, wie wir sehen, im Roman nicht nur vor. Sie sind auch Thema im Roman. Zwischen den Figuren ebenso wie beim Erzähler, wenn es etwa von „Fräulein Honig“ heißt, dass sich ihre Züge „wie ein Protest gegen ihren Namen ausnahmen“. „Scherzhafte Widerspiele“, zum „Erheitern“, wie es Treibel meint – und Lukács offensichtlich auch –, sind die Namensspiele freilich nur im „inneren Kommunikationssystem“, für Treibel und Herrn Vogelsang. Auch „Klopstock“ und „Agathon Knurzel“ gehören dazu. Für den Leser liefern sie in ihrer Fülle schon unmissverständliche Hinweise ihres Schöpfers auf den Widerspruch von Sein und von Erscheinung, fungieren als Indikatoren einer geradezu kosmischen Miss- und Dysharmonie, die saure Honig, die dürre Bomst, die korpulente Ziegenhals. Ein Fehler wäre es indes, allein die komischen in einer Art von Aaschenputtel-Semantik zu betrachten, und die „normalen“ nicht!
Denn angesichts der Fülle komischer Namen heben die „unverdächtigen“ Namen Schmidt und Treibel die bezeichneten Personen in jedem Fall jeweils heraus aus den (wenn auch unterschiedlich) verlachten Gruppen der Gymnasiallehrer und Professoren einerseits und der Hofgesellschaft.
Ein Fehler ist es ebenfalls, trotz 70 % Dialogen nur die Äußerungen der Figuren zu betrachten, nicht, was sie damit bewegen, was im Roman geschieht.
Was passiert in Jenny Treibel? Am Ende heiraten zwei Junge – und kein Alter stirbt: So ließe sich, in Anlehnung an Fontanes Abriss des Stechlin, das Geschehen des Romans zusammenfassen. Vollständiger wäre das Bild, wenn man freilich ergänzte, was am Ende alles nicht gelungen ist, auch wenn es anfangs losgetreten wurde.
Zwei groß, doch falsch gedachte Karrieren scheitern: Corinna will mit ihrem Dickkopf Leopold zum Mann, einen Sohn der Treibels, und der Kommerzienrat will mit allen Mitteln in den Reichstag, um Generalkonsul zu werden. Treibel scheitert, wie man jetzt schon ahnen kann, an seinen unbrauchbaren Hilfstruppen, die er um sich schart: Bomst und Vogelsang und Ziegenhals.
Auch Corinna scheitert, vordergründig jedenfalls, und zwar am Widerstand der Titelheldin, die selbst aus einem Krämerladen stammt, nun aber das „Haus Treibel“ gegen jegliche „Impietät“ verteidigt, wie sie betont, also „Gottlosigkeit“. Der Hybris dieses angemaßten Selbstbilds hat Corinna schon zuvor im Streit die Maske abgerissen:
„Wer sind die Treibels?“, fragt sie. „Berlinerblaufabrikanten mit einem Ratstitel, und ich, ich bin eine Schmidt.“
Es ist kaum auszuloten, ob und was sie sich wohl dabei denkt. Ihr Gegenüber, ebenfalls, im „inneren Kommunikationssystem“ nach Pfister, vermutet wohl, dass Corinna jetzt schlicht übergeschnappt sei. Diese, der die Professorenriege ihres Vaters nicht zum Vorbild gereicht, müsste Reste bürgerlichen Selbstbewusstseins aus den Winkeln kratzen, um sich darauf etwas einzubilden. Nehmen wir, im äußeren System, den Namen anfangs nur als Zeichen: Schmidt. So heißt sie. Im Roman.
Noch zuvor, als Leopold sogar der Mutter allzu brav erschienen war, so dass sie ihm glatt „was Apartes“ wünschte, hatte Treibel eingeworfen, ihr Sohn werde ja vielleicht einmal von einem ‚verflixten Weib‘, einer „Edeldame“, die durchaus auch „Schmidt“ heißen könne, ins Glück entführt werden – und niemand denkt sich etwas dabei. Niemand im Roman. Nur der Erzähler. Aber jedenfalls nicht Jenny.
Auch auf der Betrachterebene waren es bisher nicht viele, die entgegen der oben so genannten „Aschenputtel“-Semantik ihr Augenmerk auf „Schmidt“ gerichtet haben. Dabei wird der Sammelname, immerhin Verkörperung und Sitz des oft genannten „Schmidtchen“, nicht weniger als Unikat und kennzeichnend betrachtet als jedes starke Attribut. Das „Schmidtsche“, heißt es einmal, und von Schmidt, das Schmidtsche stelle alles infrage.
In einzelnen Bezügen, die man immer schon gesehen hat, mag Corinna Schmidt Fontanes Lieblingstochter Martha ähneln: „Mete“ aber heißt sie nicht. Sie heißt Corinna, und den möglichen Bezug zu einer anderen Corinna stellt sie selber her: Sie werde sich, sofern ihr Hochzeitsplan aufgehe, fühlen wie „Corinne au Capitole“, verrät sie einmal. So aber heißt der 2. Teil des Romans von Madame de Staël „Corinne ou l’Italie“, der wiederum den Hinweis auf die Lehrerin Pindars befördert, Corinna, von dem der zweimal im Roman zitierte Satz entliehen ist: „Werde, der Du bist“.
„Werde, der du bist“: Das ist zugleich das Motto von Professor Schmidt, bezogen von Pindar, für seine Tochter, für Corinna. Es soll dabei nicht übersehen werden, dass dieses „Werde, der Du bist“ ein paradoxer Lehrsatz ist: „Werden“ heißt so viel wie „Noch nicht Sein“, setzt auf Veränderung, denkbar beispielsweise als „Entstehen“, auch „Vergehen“. „Sein“ dagegen (denn es heißt ja: „der Du BIST“, nicht „der Du sein wirst“) meint das Gegenteil davon, den Zustand, das Verweilen.
Der Widerspruch, als der ein Paradox so gern empfunden wird, auch dieses, ist letztlich dadurch zu versöhnen, dass das Moment der Wandlung, das im „Werden“ aufscheint, bereits in den Begriff des „Seins“ integriert ist, und zwar dadurch, dass der Prozess des „Werdens“ angesehen wird als die Funktion des gern beschriebenen Entwicklungsfaktors „Reifung“, einer „Entwickelung“ auch der Begriffsbedeutung nach – im Gegensatz zum „modifizierenden Umgang“, dem Lernen nach Belehrung etwa als einer Form der wiederum beim Wort genommenen „Erziehung“. Das Werden, so betrachtet, geschähe demnach unbedingt. Dann freilich bedürfte der Satz des Pindar eigentlich nicht seines Imperativs! Es genügte, die „Entfaltung“ des schon „Angelegten“ nicht zu hindern, alles Störende dabei zu unterlassen.
„Werde, der du bist“ als Motto des Romans: Das ließe einen Bildungsroman als Genre erwarten, vorausgesetzt, in dessen Kontext sei das Lachen nicht verboten. Auch das Geschehen, das zum Scheitern aller falschen Ambitionen führt, ein Quantum „Belehrung“, sodann die erzählte „Bewährung“, sind Strukturprinzipien des Bildungsromans, der durch sein Mottowort vom „Werden“ es eher verdient hat, „Entwicklungsroman“ statt „Erziehungsroman“, genannt zu werden. Muss man betonen, dass es den bisher in Lustspielform noch gar nicht gab. Fontane hat das gut versteckt, indem er Jenny Treibel, wenn schon nicht auf seinen Schild gehoben hat, so doch auf seinen Deckel.
Werde, der du bist: Das lenkt den Blick darauf, dass, recht betrachtet, nicht die fürchterliche Jenny Treibel, sondern dass Corinna heimliche Hauptgestalt des Buches ist. Zumindest ist sie die einzige, die eine nennenswerte Entwicklung durchläuft. Die meisten anderen Figuren sind geradezu als „Typen“ festgelegt. Ihr Vater ahnt noch nicht, wie sehr er recht behalten wird, als er sehr früh die Lanze für sie bricht: „Das Schmidtsche strebt in ihr nicht bloß der Vollendung zu, sondern […] kommt auch ganz nah ans Ziel.“ Ganz nah, doch nicht so nah, dass die Vollendung, wie er sagt, „bedrücklich“ wird: Dagegen beschirmt sie die Selbstironie.
Wer ist Corinna – oder was? – „Ich bin eine Schmidt“, sagt sie voll Stolz. Dazu ist sie ein Holzkopf. Und was wird sie nach Pindar, der Heiligenfigur des Gymnasialprofessors Schmidt? Sie heiratet Marcell, ihren Cousin. Und der heißt: „Wedderkopp“. Ausgerechnet „Wedderkopp“! Plattdeutsch: Widderkopf! An ihm, sagt Jenny Treibel arglos scherzend im ersten Kapitel, sei „nichts weiter zu tadeln“, „als dass er Wedderkopp“ heiße. Zu tadeln deshalb, weil er so ganz und gar nichts Widderköpfiges, Dickköpfiges hat. Auch Schmidt, als Marcell bei ihm über Corinna klagt, gibt zu verstehen, dass er ein schlechter Liebhaber sei, wenn er sich so wenig durchsetze und „immer väterlichen Vorspann braucht“.
Corinna aber sie gibt den Sammelnamen Schmidt zurück, ohne doch „das Schmidtsche“ aufzugeben, über das auch Wedderkopp verfügt, immerhin ihr Cousin. Corinna Schmidt wird zu Corinna „Wedderkopp“, so passend wie Plattdeutsch: Widderkopf, so stur, wie man sie kennt, zumindest wenn es darauf ankommt: Werde, der du bist!
Sie entscheidet sich am Ende richtig.
Hier zeigt sich, dass das Namenskonzept im Roman weit unter Wert behandelt wird, wenn es bloß angewendet wird auf die Komik mancher Namen: Honig, Bomst und Ziegenhals. So wird allein das Urteil von der harmlosen „Komödie“ verstärkt.
Corinnas Umfeld, ihre Ausgangsposition, vermag sie anfangs zu erschrecken: Da gibt es die skurrile bildungsbürgerliche Auswahl, Kollegen ihres Vaters, die sich wie einander auch „Die Sieben Waisen Griechenlands“ nennen, Professor Rindfleisch, Professor Hannibal, die Schmolke als Ersatz-Mama mit ihren Ritualen!
Sie ahnt und sie sagt es im Gespräch mit Marcell: „Das, wozu der liebe Gott mich so recht eigentlich erschuf, das hat nichts zu tun mit einem Treibelschen Fabrikgeschäft“. Doch genauso hadert sie mit jener Enge ihrer Lebenswelt, die sie nicht als Bestimmung akzeptieren kann: „‚Sich einschränken‘, ach, ich kenne das Lied.“ Demgegenüber sehnt sie sich „an ferne, glückliche Küsten“. Sie kennt und nennt dazwischen ihre Position: „Ein Hang nach Wohlleben, der jetzt alle Welt beherrscht, hat mich auch in der Gewalt“. Sie ist ein Kind ihrer Zeit.
Und deshalb wirft sie einen Stein ins Wasser, dessen Ringe den Kapiteln des Romans entsprechen, besinnt sich ihres „Evarecht[s]“ und startet die Versuchsanordnung, die ihr Cousin Marcell nur als „Komödie“ begreifen kann. Viermal fällt das Wort in dem Gespräch.
Hinzu kommt, ja, es ist das Eigentliche: Corinna Schmidt hat einen Dickkopf, und sie hat vor allem anderen zu lernen, dass man alleine damit nicht gut weiterkommt. Es stimmt auch, dass Leopold Treibel, der Sohn aus der öden Besitzbürgerschicht, der von Corinna buchstäblich „total weg“ ist und sich alsbald mit ihr verlobt, sich daraufhin an seiner Mutter sehr bildlich die Zähne ausbeißt. So heiraten schließlich die Jungen erwartungsgemäß: Leopold seine Schwägerin Hildegard aus der Konsulsfamilie Munck, Corinna den Cousin Marcell, der passend dazu gerade zum „Gymnasial-Oberlehrer“ ernannt worden ist. Und ja, selbst das ist wahr: Am Ende aller Handlungsbögen siegt die kitschig affizierte Jenny „née Bürstenbinder“.
Es ist indes ein Sieg bloß auf Papier, in der Welt des Romans. Wir, in der Wirklichkeit, wir wissen spätestens seit Brecht, dass es nicht darauf ankömmt, die Courage sehend zu machen. Sehen soll das Publikum. Und dann nicht einfach sagen: Ja, so ist es. Sondern: schlimm, dass es so ist. Das muss man schleunigst ändern!
Auch der Aufruhr in beiden Familien, Treibel und Schmidt, ändert eigentlich nicht viel. Er war, als Stück, ein Sturm im Wasserglas, in dem das Wasser sich zur Ruhe schwingt. Geld legt sich, wie meist, zu Geld, Frau Jenny Treibel braucht sich nicht zu ändern, Corinna bleibt im Bildungsbürgertum verankert, auch wenn Marcell doch unter Menschen noch ein wenig unrund läuft. Treibel, der normalste aus der Sippe, kriegt dagegen eine Packung: Er wollte in die Politik und hat sich ausgerechnet Leutnant „Vogelsang“ als Wahlkampfleiter dafür ausgesucht, den komischen Reaktionär mit dem zwitschernden Namen. Sie scheitern im Verein, und Treibel, wenn er klug ist, verbucht das unter „Lehrgeld“. Und so klug ist er allemal! Augen auf in Politik und Partnerwahl: So könnte auch der Untertitel lauten. Er zieht es aber vor, ein wenig irreführend zu zitieren. Jenny Treibel wäre einverstanden.
Uns aber zeigt der alte Grieche in Komplizenschaft mit seinem Autor, dass mit der wichtigsten Figur des Buches alles richtig ist. Ihr neuer Name zeigt es an. Der Namenswechsel wäre aber einzig ein erzählerischer Taschenspielertrick, der nichts bewirkte, wenn ihm nicht ein Seinsprinzip zugrunde läge, das in diesem Falle Goethe schon beschrieben hat: die Vorstellung einer schaffenden Polarität, mit Evidenz beobachtbar am Wechselspiel des Blutdrucks und dem Rhythmus von Systole und Diastole, von Kontraktion und Dilatation, von Enge und Weite.
Wie beim Herzschlag oder auch beim Atmen ist das Wechselspiel von Systole und Diastole das Funktionsprinzip des Lebens. Es strukturiert auch das Geschehen des Romans: Es ist nichts, was der interessierte Leser als Theorem heranträgt, nein, es wird erzählt und fachgerecht benannt: Leopold, Corinna träumen beide von der Ferne und dem unerreichten Unerreichbaren, Coorinna wünscht sich „an ferne, glückliche Küsten“. Was die beiden vermutlich nicht wissen, haben wir Diastole genannt. Dass Corinna an der Enge leidet, am systolischen Zustand, ist für sie der Antrieb ihres Tuns. „‚Sich einschränken‘, ach, ich kenne das Lied“, klagt sie vor Marcell.
Auf dem Höhepunkt der problematischen Entwicklung wendet sie sich an die Schmolke, die gerade Birnen vorbereitet. Und was sagt „Mutter“ Schmolke zu Corinna, die sonst ja keine Mutter hat und keinen mütterlichen Rat? Nimm eine Birne! Birne adstringiert: Soll heißen, Birne zieht zusammen – was sie tatsächlich tut. In diesem Zustand, in der Systole, sieht endlich auch Corinna ein, dass Leopold für sie nur ein Gefährte auf dem Holzweg wäre. Allein der Umstand, dass „die Schmolke“, ganz auf sich allein gestellt, inmitten lauter Professoren einerseits und all dem vielen Geld aus „Preußisch-Blau“ (Treibel macht sein Geld mit Farben, ausgerechnet noch dem Farbton für die Uniform), im Zweifel ihre „Frau“ steht, hätte Lukács reichen können für ein klüger gewichtetes Urteil. Er aber wollte partout in der Oper sehen, wie einmal Gnade vor Recht ergeht und die Emporkömmlingsgemahlin auf die Nase fällt, ihr Luftkissen zumindest seine Luft verliert.
Corinna löst ihre Verlobung und lässt Leopold fallen, das Bauernopfer des Romans. Er war ihr eigentlich zuletzt nur noch ein Buch mit sieben Siegeln. In der Heirat mit Marcell stimmt sie zwar der Systole des bürgerlichen Lebens zu. Doch vorher gehen Sie – nein, nicht „nach Hause“, wie es Schmidt im Schlusssatz anregen wird, sondern weit hinweg, mit Schliemann nach Mykene und transzendieren den Roman, Marcell als Archäologe und sie als seine Ehefrau, Corinna Wedderkopp, geb. Schmidt.