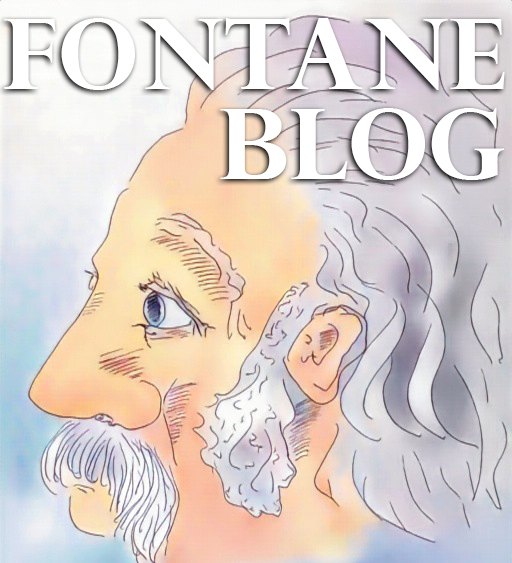Zum Programm unsres Fontane-Kreises gehörte von Beginn an, auch lebenden Schriftstellern näherzukommen, vor allem solchen, die sich Fontane besonders verbunden fühlten. Am intensivsten gestaltete sich unsere Beziehung zu Günter de Bruyn. Von ihm hatte ich Mitte der 1980er Jahre schon mehr gelesen als von Theodor Fontane. Berührte mich sein Erstling Der Hohlweg noch kaum, so nahmen mich einige der folgenden Erzählungen – Buridans Esel, Märkische Forschungen, Preisverleihung – für diese Art zu schreiben ein. Günter de Bruyns Gründlichkeit, sein trockener Mutterwitz und nicht zuletzt die hintergründige Benennung schlimmer, offiziell verschwiegener Fragwürdigkeiten in der DDR kamen auch meinem Bedürfnis realistischer Schilderung gegenwärtiger Wirklichkeit entgegen.
In der Reihe „Märkischer Dichtergarten“, die er zusammen mit Gerhard Wolf herausgab, war nun eine von ihm besorgte Auswahl der Wanderungen Fontanes angekündigt worden. Sie in unserem Kreise vorzustellen, wollte ich ihn bitten. Das war aber gar nicht so einfach. Niemand konnte, sollte oder wollte mir sagen, wie und wo ich den zurückgezogen lebenden Schriftsteller erreichen konnte. Ein Zufall half mir schließlich auf die Sprünge: Die Stadt- und Kreisbibliothek Königs Wusterhausen hatte zu einer Lesung de Bruyns aus seinem damals jüngsten Roman Neue Herrlichkeit eingeladen. Auf den war auch ich neugierig, und diese Gelegenheit gedachte ich zu nutzen.
Damals wusste ich noch nichts von der politischen Brisanz dieses Buches und kannte das Drama um seine Herausgabe in der DDR nicht. Erst Jahre später kam es mir zu Ohren. Zum besseren Verständnis der Überraschung, die mich dann in der Kreisbibliothek erwartete, sei es kurz mitgeteilt.
Der Roman spielt – leicht verschlüsselt – in der Gegend von de Bruyns Wohnsitz im Beeskow-Storkowischen. Auf Betreiben seiner Mutter bezieht der Sprössling eines hohen Staatsfunktionärs dort ein Heim für Schriftsteller, genannt „Neue Herrlichkeit“. Fern von verführerischen Ablenkungen soll er dort eine Doktorschrift zu einem Thema aus preußischer Geschichte zu Papier bringen. Zwar erwartet man nichts Neues von ihm, doch soll ihm der Doktortitel zum Einstieg in den diplomatischen Dienst verhelfen. An all dem liegt ihm eigentlich (gar) nichts. Nur widerwillig fügt er sich in das von ihm Verlangte, verbummelt aber bald schon die Zeit mit einem Liebesabenteuer. Als dessen „natürliche Konsequenzen“ zutage treten, drückt er sich vor ihnen, lässt die junge Frau sitzen und mit Geld abfinden. Diese Fabel entfaltet de Bruyn im Alltag des fiktiven märkischen Provinznestes und deckt mit dessen penibler Schilderung beiläufig Befremdlichkeiten realsozialistischer Wirklichkeit auf, die so gar nicht zu deren makellosem Selbstbildnissen passten.
Das gab Ärger. Man verlangte Änderungen. Vor allem musste der Vater der Hauptfigur von der obersten Funktionärsebene heruntergenommen werden. Erst nach solcherlei „Entschärfungen“ wurde der Druck 1983 bewilligt. Doch der verzögerte sich nun „aus technischen Gründen“. Unterdessen erschien aber eine westdeutsche Lizenzausgabe: ohne Änderungen, hochgelobt von der dortigen Kritik. Dass man es dazu hatte kommen lassen, trug dem Kulturministerium und dem Mitteldeutschen Verlag geharnischte Rüffel seitens der Parteiführung ein. Die Genehmigung zum Druck musste widerrufen und die bereits ausgedruckte Auflage von 20 000 Exemplaren eingestampft werden. Dies wiederum löste eine heftige Kontroverse zwischen den ideologischen Betonköpfen und ihren Vollstreckern in der Kulturbürokratie einerseits und deren Gegnern im Verlagswesen andererseits aus; denn inzwischen war das Buch zu einer begehrten Schmuggelware im West-Ost-Verkehr geworden, wovor die Kritiker all dieser unsinnigen Restriktionen (unter ihnen Klaus Höpke, Leiter der Hauptverwaltung Literatur im Kulturministerium) beizeiten gewarnt hatten.
Am Ende kam eine neuen Druckerlaubnis für nun aber nur noch 15 000 Stück zustande, und 1985, mit zwei Jahren Verspätung, konnte das Buch endlich ausgeliefert werden. Die viel zu geringe Auflage steigerte die ohnehin große Nachfrage noch und machte den Titel zu einer Bückware, deren sich durch Beziehungen zu verständnisvollen Buchhändlern und allerlei Tricks zu versichern man inzwischen (aber) gelernt hatte.
Als ich den geräumigen Lesesaal der Bibliothek betrat, war er schon überfüllt. An die 150 Leute waren gekommen. Viele fanden keinen freien Stuhl mehr, mussten stehen. Und so stand man eben. Der Kreisvorsitzende vom Kulturbund begrüßte Autor und Gäste in lapidarer Kürze. Dann stellte de Bruyn sein Werk vor: sachlich, leise, jede anzügliche Anspielung vermeidend. Er las – ja, wie: gleichmütig, lustlos, einige Textabschnitte, verband sie mit kurzen Ein- und Überleitungen, um die Handlung deutlich werden zu lassen. Blass hockte er am Tisch, das aufgeschlagene Buch vor sich, als wolle er sich dahinter verbergen. Unwohl schien er sich zu fühlen, wie wenn ihn Magenschmerzen plagten. Ohne Pause ging es in die Diskussion, und der Fragen gab es viele. Zur Figurenzeichnung: warum so negativ und nicht anders? – So sei eben das Leben. – Mehr und mehr aber dann zum Verhältnis von Schilderung und realsozialistischer Gegenwart überhaupt. Wie das auf dem Schriftstellerkongress jüngst angesprochen worden sei, wollte jemand wissen? Was er von der Zensur im Kulturbetrieb der DDR halte? Je mehr sich die Fragen politisch aufluden, desto unbehaglicher wurde es für de Bruyn. Er wand sich förmlich, bat darum, sich doch bitte auf das Buch zu beschränken und beteuerte, zu „all den anderen Dingen“ jetzt weder etwas sagen zu können, noch sagen zu wollen.
Eine peinliche Stille entstand. In die Stille hinein fragte ich ihn, wie er zu Theodor Fontane stehe. Und es war, als ob diese Frage eine Fessel bei ihm löste: Das könne man eigentlich seinem Schreiben anmerken, wenn man es genau lese. Fontane sei für ihn nicht bloß irgendeiner, er sei für ihn in seiner Lebensnähe und Genauigkeit, ja, auch in seiner kritischen Sicht auf preußische Zustände seiner Zeit, ein großes Vorbild. Doch solle man auch Fontane – wie überhaupt jedem Schreiber – nicht jedes Wort glauben… –
Mit der Frage nach Fontane nahm der Abend noch einen entspannten Ausgang. Als ich Günter de Bruyn danach abwartete und zum Bahnhof begleitete (er war mit dem Regionalzug aus Beeskow gekommen), bedankte er sich nahezu überschwänglich für die „Hilfestellung“, nahm unsere Bitte freundlich auf, gab gleichwohl zu bedenken, seine Hauptbeschäftigung sei das Schreiben, nicht das „Drüberreden“.
 Es bedurfte dann noch unserer Geduld und einiger brieflicher Verständigungen, bis wir ihn im Jahr darauf – im Herbst 1988 – erstmals in Zeuthen empfangen konnten. Viele Zuhörer erwarteten ihn auch hier, doch heikle Fragen blieben ihm diesmal erspart. Es war eine freundliche Begegnung, un weitere schlossen sich an. Auch der Fontane-Gesellschaft, zu deren Gründung ich ihn im Namen des Vorbereitungskomitees einlud, trat er bei. Es fügte sich, dass wir uns am 15. Dezember 1990 im Potsdamer Claudius-Klub erfreut die Hände schüttelten. 1992, während der Gosener Jahrestagung, begleitete er uns auf unserer Fahrt durch das Oderland. Und 1997, als wir zur 7. Jahresversammlung nach Zeuthen einluden, gewann ich ihn für einem Vortrag über Fontanes Spreeland und zum Cicerone durch Beeskow und Schloss Kossenblatt.
Es bedurfte dann noch unserer Geduld und einiger brieflicher Verständigungen, bis wir ihn im Jahr darauf – im Herbst 1988 – erstmals in Zeuthen empfangen konnten. Viele Zuhörer erwarteten ihn auch hier, doch heikle Fragen blieben ihm diesmal erspart. Es war eine freundliche Begegnung, un weitere schlossen sich an. Auch der Fontane-Gesellschaft, zu deren Gründung ich ihn im Namen des Vorbereitungskomitees einlud, trat er bei. Es fügte sich, dass wir uns am 15. Dezember 1990 im Potsdamer Claudius-Klub erfreut die Hände schüttelten. 1992, während der Gosener Jahrestagung, begleitete er uns auf unserer Fahrt durch das Oderland. Und 1997, als wir zur 7. Jahresversammlung nach Zeuthen einluden, gewann ich ihn für einem Vortrag über Fontanes Spreeland und zum Cicerone durch Beeskow und Schloss Kossenblatt.
Er mochte mich irgendwie. Als mich Helmuth Nürnberger gelegentlich mal mit de Bruyns Landlehrer Pötsch verglich, bedankte er sich brieflich bei der Gattin des Ehrenpräsidenten mit der Bemerkung, dies ehre auchihn. So war er.
 Eines schönen Frühherbsttages wollten meine Frau und ich ihn in seinem verborgenen Anwesen neben den Resten der einstigen Blabbermühle nahe Görsdorf eine Stippvisite machen. Fast wären wir mit unserem Trabant im losen Sand des schmalen Zufahrtsweges steckengeblieben. Es sollte wirklich nur ein kurzes Hereinschschauen werden, darum hatte ich uns nicht angemeldet. Nun fanden wir das Häuschen leer und verschlossen. Zum Glück! Denn wie er mir später zu verstehen gab, hielt er von derlei Störungen in seiner Abgeschiedenheit wenig. Auf einem grob gezimmerten Tisch neben der Haustür stand eine Schale mit kleinen, rotbäckigen Äpfeln von der Streuobstwiese hinterm Haus. Sie verlockten mich, einen zu kosten, und er schmeckte mir besser als sonst diese Sorte. Wie angenehm Sympathie doch selbst das Säuerliche machen kann, nach dem man sonst den Mund verzieht!
Eines schönen Frühherbsttages wollten meine Frau und ich ihn in seinem verborgenen Anwesen neben den Resten der einstigen Blabbermühle nahe Görsdorf eine Stippvisite machen. Fast wären wir mit unserem Trabant im losen Sand des schmalen Zufahrtsweges steckengeblieben. Es sollte wirklich nur ein kurzes Hereinschschauen werden, darum hatte ich uns nicht angemeldet. Nun fanden wir das Häuschen leer und verschlossen. Zum Glück! Denn wie er mir später zu verstehen gab, hielt er von derlei Störungen in seiner Abgeschiedenheit wenig. Auf einem grob gezimmerten Tisch neben der Haustür stand eine Schale mit kleinen, rotbäckigen Äpfeln von der Streuobstwiese hinterm Haus. Sie verlockten mich, einen zu kosten, und er schmeckte mir besser als sonst diese Sorte. Wie angenehm Sympathie doch selbst das Säuerliche machen kann, nach dem man sonst den Mund verzieht!
 Sympathie von Dauer führte mich und meine Tochter Sonja vorigen Sommer nach dem Besuch der de Bruyn-Ausstellung auf Burg Beeskow noch einmal zu der Einsiedelei am Blabbergraben.
Sympathie von Dauer führte mich und meine Tochter Sonja vorigen Sommer nach dem Besuch der de Bruyn-Ausstellung auf Burg Beeskow noch einmal zu der Einsiedelei am Blabbergraben.
Dem alten Schäferhaus gegenüber hatte sich ein zweiter Hauskomplex hinzugesellt, die Fensterreihen im Dachgeschoss nach Osten und Süden gerichtet:
 de Bruyns Schreib-Refugium, umzäunt, versperrt, verlassen. Wir fuhren weiter zu dem kleinen, westlich benachbarten Schwenower Waldfriedhof und nahmen an der schlichten Grabstelle stumm Abschied von dem gewissenhaften, mitteilsamen Einzelgänger, der er bis zuletzt geblieben war.
de Bruyns Schreib-Refugium, umzäunt, versperrt, verlassen. Wir fuhren weiter zu dem kleinen, westlich benachbarten Schwenower Waldfriedhof und nahmen an der schlichten Grabstelle stumm Abschied von dem gewissenhaften, mitteilsamen Einzelgänger, der er bis zuletzt geblieben war.
Fotos vom Verfasser.