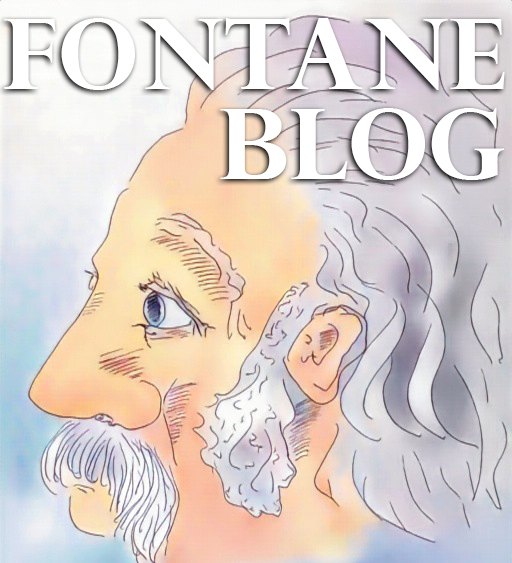Peter Wruck (1932-2007) – erste Erinnerungen und eine Grabrede
In der kleinen Einführung zu der neuen Rubrik Fontane-Menschen: Erinnerungen habe ich bereits den Namen von Peter Wruck erwähnt. In meinen Unterlagen versammelt sich unter seinem Namen das umfangreichste Material. Von der ersten Begegnung an war mir seine Person so wichtig, dass ich jede Karte, jeden Brief aufbewahrte. Als er 1997 in den Ruhestand ging, überließ er mir seine Ordner, später kamen Notizen, Briefschaften, Gutachten und anderes hinzu. Eine Zeitlang beabsichtigte ich, seine verstreut publizierten Arbeiten zu sammeln und mit einem aufgeschlossenen Studenten zu veröffentlichen, mit kurzen Kommentaren versehen und einem Lebensbild seiner Persönlichkeit. Mein Mangel an Zielstrebigkeit ließ das Beabsichtigte versanden. Die Notwendigkeit einer solchen Publikation bleibt bestehen: zumal es sich nicht nur um ein ergiebiges Kapitel Fontane-Forschung handelt, sondern gleichermaßen um ein vielschichtiges Rezeptionskapitel in der DDR.
Erst als Prüfling im Staatsexamen 1977 hatte ich Peter Wruck kennen gelernt. War es Sympathie auf den ersten Blick? Von meiner Seite zweifellos. Der Zufall ermöglichte mir, an seinem Doktorand:innen-Seminar teilzunehmen. Wir lasen Heine, Marx und Nietzsche, beschäftigten uns mit dem Streit um Herweghs Partei-Gedicht, wogen Lassalles Drama Franz von Sikkingen und warfen einen Blick in Bismarcks Parlamentsreden. Was wir am Ende unseres Studiums geahnt hatten, bestätigte jede Sitzung: Unser Wissensfundus war unbedeutend, unsere literaturtheoretische Kenntnis einseitig unbeholfen und von einem angemessenen Umgang mit literaturgeschichtlichen Phänomenen konnte die Rede nicht sein. Wruck kommentierte die Menge der Mängel nicht, wir fühlten sie schmerzlich – und beglückt: Denn er demonstrierte, was uns fehlte, und führte vor, wie sich das, vielleicht, beheben ließ. Ohne uns vorzuführen. Sein Habitus gab das unverdiente Gefühl von Ebenbürtigkeit. Wir nickten verlogen, wenn er auf einen uns gänzlich unbekannten Text mit den Worten „Sie werden ihn kennen, ich verrate Ihnen da nichts Neues“ verwies. Nach Sitzungsschluss eilten wir in die Bibliothek, um wenigstens diese Lücke umgehend zu schließen. Fontane stand, wenn ich mich recht entsinne, nicht auf dem Programm. Wruck zögerte in diesen Jahren, ihn in Seminaren oder bei Prüfungen zum Thema zu erheben. Wann er zwischen uns Gesprächsgegenstand wurde, vermag ich nicht mehr zu sagen. Vermutlich aus einer seiner beiläufigen Bemerkungen, nebenher eingeworfen, Beiwerk („will das hier gar nicht vertiefen“) und dadurch doppelt wirksam.
Als er mir einen Aufsatz über Fontanes „Preußische Idee“, der in den Fontane Blätter erschienen war, mit den Worten in die Hand drückte „Wird Sie vielleicht interessieren, sollen allerdings viele Druckfehler drin sein – lassen Sie sich davon nicht abschrecken. Sind mir schrecklich genug“, wusste ich nichts über die Hintergründe. Unbekannt war mir, dass dieser Aufsatz Wrucks wissenschaftliche Rückkehr zu Fontane bedeutete. Wir hatten von Konflikten gehört, auch dass sie sich um seine Dissertation „Preußentum und Nationalschicksal bei Theodor Fontane. Zur Bedeutung von Traditionsbewußtsein und Zeitgeschichtsverständnis für Fontanes Erzählungen Vor dem Sturm und Schach von Wuthenow“ (1967) rankten, wusste aber nichts Genaues. Die Arbeit selbst war nicht zu beschaffen; wir hatten es nach kurzem Anlauf aufgegeben. Gerüchte um Gutachten kursierten, wir ließen sie auf sich beruhen. Wrucks Gegenwart war uns wichtiger als eine Vergangenheit, an die offensichtlich nicht einmal er rühren mochte. Der Umstand seiner Parteilosigkeit bestärkte mich in der eigenen Reserve gegenüber einer solchen Mitgliedschaft.
Ich las den Aufsatz, meine erste Lektüre-Begegnung mit dem, was wir bald den „Wruck-Ton“ nannten – wie sich unter seiner Schülerschaft, die im Verlauf der achtziger Jahre entschieden heranwuchs, der Terminus „Wruckismus“ einbürgerte. Gemeint waren dabei Formulierungen, in denen sich überlegene Sachkenntnis und ironisierende Selbstaussagen auf sonderliche Weise mischten. „Das hat sogar mich überrascht“ etwa oder, nach informationsdichten Ausführungen, „dies alles versteht sich weitgehend von selbst, wäre da nicht […]“. Da die kleine Studie auf Archivbeständen beruhte, die mich bis dahin nicht weiter interessiert hatten, erkundigte ich mich nach dem Fontane-Manuskript. „Sieh‘ da. Dachte es mir fast“. So oder ähnlich lautete seine Erwiderung auf meine Nachfrage. Er wolle um die Jahreswende mal raus nach Potsdam, vielleicht habe ich Lust und Zeit. „Immerhin sind Sie Familienvater.“ War das Ironie, war das Ernst? Es sei dahingestellt. Der Archivausflug kam zustande, wir wurden in einer weit geöffneten Tür der Dortustraße in Potsdam vom Archivleiter, Dr. Otfried Keiler (1931-2016), empfangen, und nach einem Kaffee führten mich die beiden Herren, die sich bestens zu verstehen schienen, in die Fontane-Handschriften-Welt ein.


Traueransprache für Peter Wruck
[Berlin-Pankow, Friedhof Pankow III, Am Bürgerpark 24, 13. Dezember 2007, 13:00 Uhr]
Liebe Verwandte, Bekannte, Freundinnen und Freunde von Peter Wruck,
das Leben dessen, dem unser Beisammensein heute und an diesem Ort gilt, begann am 10. Juni 1932 in Breslau und es endete am 2. Dezember 2007 in seiner Wohnung in Pankow. Hier, in der Achtermannstraße 49, war Peter Wruck zu Hause seit 1959. Sein letzter Blick fiel nicht auf graue Krankenhauswände, sondern sah Vertrautes, von ihm und seiner Familie Eingerichtetes. Eine Verabredung mit den Söhnen stand ins Haus, der erste Advent versprach ein Tag der Zuwendung zu werden. So einsam Altern ist, drohte keine Einsamkeit. Der Tod, der diesen Augenblick zum letzten werden ließ, kam unerwartet. Kein Vorbote kündigte ihn an, alle Anzeichen einer Bedrohung fehlten. „Man kann“, heißt es bei Fontane, „nicht still genug in seine letzte Wohnung einziehn.“
Was, wir wünschen es, Gnade für Peter Wruck war, ist uns Anlass zu großer Traurigkeit. Wir hätten, in Abwandlung eines Wortes von Ilse Aichinger, nicht jenes Abschiedslicht benötigt, um zu wissen, was uns Peter Wruck war. Auf einen solchen Abschied ohne Übergang waren wir nicht vorbereitet und sind es noch immer nicht. Wie gerne hätten wir uns noch in Rücksichtnahme geübt – und können nun nicht mehr, als Rückschau halten. Eben haben wir noch gemeinsam an einem Tisch gesessen, ein Glas Wein geleert und uns der Geborgenheit gefreut, die in jenem „Bis bald“ lag, mit dem wir uns trennten. Eben war noch Zukunft und kein Grund, um über ihre Grenzen nachzudenken – trotz aller Besorgnisse der letzten Monate. Wer Ende September 2007 bei der kleinen Fontane-Tagung ihm zu Ehren im Senatssaal der Humboldt-Universität dabei sein konnte, der sieht Peter Wruck neben dem Rednerpult stehen und sich verbeugen – und glücklich über Menschen, die ihm wohl wollen und denen sein Wohlwollen gilt seit Jahr und Tag. Nein, wir sind mit diesem Tod nicht einverstanden und haben doch keine andere Waffe, ihm zu widerstehen als unser Erinnern. Mit dem Erinnern bleibt Gegenwart, was das Sterben als vergangen besiegeln will.
Von der Bedeutung, die prüfbare Daten und Fakten in einer Biographie haben, war Wruck überzeugt. Ihnen in einer Grabrede Rechnung zu tragen, verstand sich ihm von selbst. „Das, lieber Herr Berbig, sind obligatorische Gattungsmerkmale eines Nachrufs“. Lesen, Rechnen und Schreiben lernte er in der Grundschule in Breslau-Lissa, und das, was darauf aufbaut, in der Breslauer Elisabeth-Oberschule. Die Flucht vor der näher rückenden Front Februar 1945, die den Schulabschluss verzögerte, schien ihm, so schreibt er in einem ungewöhnlichen und eindrucksvoll verfassten Lebenslauf 1951, „anfangs ein großes Abenteuer, an dem das Bedauerlichste war, dass es mich ein volles Bücherregal und mein eigenes Zimmer kostete.“ Doch dieser Preis wurde aufgewogen. Der alles verlor, was man gemeinhin Heimat nennt, der mit seiner Mutter westwärts floh und das zerbombte Dresden mit anhaltend-tiefem Schrecken als Glutfläche aus dem vorbeifahrenden Zug sah, um dann in Ronneburg und endlich im thüringischen Erfurt wieder zum Schüler zu werden, datierte seine eigene bewusste geistige Entwicklung vom Ende der NS-Zeit her.
Heinrich Bölls Resümee „Schule, ja, auch“, hätte Wruck mit einem „Schule, ja, gewiss“ gekontert. Die Zeugnisse mit der alles beherrschenden Note „Sehr gut“ waren Beruhigung für seinen Vater, der als Brückenbauingenieur bei der Bahn tätig war, und für seine Mutter. Beruhigend für ihn selbst waren sie nicht: Als er 1951 sein Abitur ablegte, beklagte er, was anderen Grund zu Freude gewesen wäre: eine fehlende einseitige Begabung. Sein Selbstbild und Fazit im erwähnten Lebenslauf: „Ein Mensch, der Lichtenberg liest, den Werther und Heine, der mit Vergnügen gute Musik hört, ohne Kenner sein zu wollen, der gerne ein schönes Bild sieht und es haßt, aus dem Schönen eine Wissenschaft zu machen, ein Mensch, der ebenso gut einmal eine Nacht durchtanzt wie er sie einem Gedanken oder einer Arbeit opfert, der sich an Idealen Ehre, Redlichkeit und – vielleicht – Liebe erhalten hat […].“ Was sollte aus einem solchen Menschen werden? Wir wissen es und nicht erst jetzt.
Wruck ließ das Pendel seiner Begabungen zwischen Natur- und Geisteswissenschaften erst einmal in Richtung Bergakademie Freiberg ausschlagen und verschaffte sich in der Maxhütte, im SAG Kali Bismarckshall und Oelsnitz nachhaltige Eindrücke einer harten Arbeitswelt. Einmal als Bergmann gearbeitet zu haben, war ihm zeitlebens – und nicht grundlos – Anlass zu bescheidenem Stolz. Doch das Gegenpendel ließ nicht auf sich warten. Es brachte ihn an den Ort, der ihm Bestimmungsort wurde: an die Humboldt-Universität zu Berlin. Von 1952 bis 1956 studierte er hier mit vergleichbar mustergültigen Noten Germanistik und schloss den Studiengang für Diplomanden mit erweiterter literaturwissenschaftlicher Ausbildung und einer Studie über Johann Gottfried Seume ab. Wie die christliche Weltsicht seiner kritischen Prüfung nicht Stand gehalten hatte, so der Marxismus. Der Partei, die dessen Deutungshoheit als Machtanspruch für sich reklamierte, vermochte er, so sehr sein Herz zeitlebens ‚links’ schlug, nicht beizutreten. Seiner Einstellung als wissenschaftlicher Assistent folgte 1961 die Höherstufung als Oberassistent, 1970 erwarb er die Facultas docendi, die attestierte Lehrbefähigung. 1978 berief man ihn, der längst Fachkommissionen leitete und grundlegende Partien einer Geschichte der deutschen Literatur verfasst hatte, zum Hochschuldozenten. Eine fachwissenschaftlich gesehen sinnfreie, latent disziplinierende Delegierung an die Moskauer Universität nutzte er auf seine Weise. „Dort bin ich Ski gelaufen und habe den kompletten ‚Heine‘ gelesen, beides“, so Wruck in unverwechselbarem Plaudern, „nicht zu verachten.“ Erst nach einem kränkenden Kampf, der angesichts seiner allseits angesehenen Lehr- und Forschungsleistung für ihn verletzend war, konnte er 1987 seine Berufung zum außerordentlichen Professor durchsetzen. Zwei Projekte – zum literarischen Leben Berlins und zur Literaturgeschichte der hauptstädtischen Universität – wurden nun möglich. Die besten seiner Studierenden hatten sich längst in Wruck-Schüler verwandelt und blieben es.
Seine untadlige Haltung und eine Integrität, die ihresgleichen sucht, ließen ihn zur maßgeblichen und Maßstab setzenden Persönlichkeit während der politischen Wende 1989/90 und den Folgejahren werden. Die Personalstrukturkommission und die Strukturberufungskommission, die die Germanistik an der Humboldt-Universität neu einzurichten hatten, fanden in Peter Wruck einen Menschen, der durch Sachkompetenz, Besonnenheit und Einfühlungsvermögen wesentlichen Anteil am Erfolg jener heiklen und in der Rückschau zunehmend problematischen Einrichtungen hatte. So wie Wruck in DDR-Zeiten, als persönlicher Verrat legalisierte Umgangsform geworden war, vornehme Diskretion im persönlichen Umgang pflegte, ja demonstrierte, so widerstand er jetzt jeder lauten Aufforderung oder leisen Einflüsterung nach Rache und Richteramt. In Thomas Cramer, dem sein anhaltend hoher Respekt galt, hatte er auf westlicher Seite einen gleich gesonnenen Partner von Rang zur Seite. Wer die beiden erlebt hat und wer Zeuge ihrer unbestechlichen Einvernehmlichkeit gewesen ist, der bekam damals einen Begriff, welches positive Potential in jenem historischen Umbruch lag.
Seit dem 1. Dezember 1992, so liest es sich in Paragraph 2 seines Dienstvertrages vom 20. Januar 1993, war Wruck „berechtigt, die Bezeichnung ‚Universitätsprofessor’ zu führen.“ Fünf Jahre blieben ihm bis zu seiner Emeritierung, den über die Jahre verlorengegangenen Boden gut zu machen. Denn anders wird man das, was die Möglichkeiten wissenschaftlichen Arbeitens anbelangt, nicht nennen können. Die Selbstverständlichkeit, mit der heute in der Fontane-Forschung Wrucks Name als einer der besten genannt wird, war alles andere als selbstverständlich. 1959 hatte Wruck sich entschlossen, die verabredete Dissertation unter das Arbeitsthema „Das Spätwerk Gottfried Kellers“ zu stellen. Eine alte, nie aufgegebene Liebe zu Kellers Werk stand dabei Pate – aber sie verblasste, als eben jener Autor von Wruck Besitz ergriff, bei dem sich wissenschaftliches Interesse, politische Herausforderung und persönliche Anziehungskraft verknüpften wie bei keinem: Theodor Fontane. Der Weg von einer ersten Tagebuchnotiz des 17Jährigen unter dem 20. März 1949 „‚Irrungen Wirrungen’ hätten den besten Hintertreppenroman abgeben können, was den Stoff anbetrifft – und was hat Fontane daraus gemacht!“ bis zu seiner mustergültigen Interpretation dieser Erzählung 1985 war weit – und er ist gezeichnet durch einen scharfen, unabgegoltenen Schnitt.
1967 verteidigte Wruck seine Dissertation „Preußentum und Nationalschicksal bei Theodor Fontane“ mit „summa cum laude“. Sie widmete sich eingehend dem ‚mittleren Fontane’ und nahm damit jenes Forschungsfeld vorweg, das erst – dank glücklicher Umstände und dank des bahnbrechenden Hauptvortrags von Wruck auf einer nicht anders als legendär zu nennenden Konferenz in Potsdam 1986 – Mitte der achtziger Jahre seinen ihm gebührenden Platz eroberte. Dass die Dissertation bis auf den heutigen Tag kaum mehr als eine Handvoll Leser hatte, verdankt sie der beklemmenden Vereitelungstaktik von Verlagsseite, bei der ein Gutachten, das eine Neuschrift verlangte, eine beschämende Rolle spielte. Wrucks Arbeit blieb ungedruckt, sie unterlag einem Kalkül von Macht und Markt, auf das einzulassen sich ihr Verfasser außerstande sah. Für Jahre zog sich Wruck aus der Fontane-Forschung zurück. Otfried Keiler, damals Leiter des Theodor-Fontane-Archivs, erst vermochte es, ihn Anfang der achtziger Jahre in die wissenschaftliche Welt der Fontane-Forschung zurückzulocken. Dafür kann ihm nicht genug gedankt werden.
Dass Wruck, nachdem er 1990 Mitbegründer und Vorstandsmitglied der Theodor Fontane Gesellschaft geworden war, forschungsergiebige und bindungsstiftende Konferenzen auf die Beine stellte, dass er eine Zeitlang Fontane-Tage an seiner Universität durchführte und dass sein Name den anständigen und respektierten Klang gewann, an dem seinem Träger lag – das ist mehr als eine schöne Genugtuung jenen, die ihm zugetan sind und nicht vergessen haben, wie gefährdet und hinderungsreich diese berufliche Laufbahn war.
Beruf, Literatur und Kunst, das ist eine Seite. Und die andere?
„[…] dieses sich eins Fühlen mit der Welt! Glücklich bin ich, und herrlich ist das Leben“. Wie fröhlich und unbeschwert ist dieses Gefühl, das das Tagebuch unter dem 6. März 1949 festgehalten hat. Wer sich an Peter Wruck erinnert, sieht ihn ja auch umgehend in ein Dasein voll Freude und Lust versetzt. Jede und jeder von uns hat ihre und seine Bilder an gemeinsam verlebte Zeiten, die kostbar sind und unverzichtbar über den Tod hinaus: ihm überlegen. „Einmal“, so erzählte mir Peter Wruck vor Jahren, „bin ich mit Edith, meiner Frau, am Bodensee gewesen, wir haben uns ein Boot besorgt, sind gerudert und irgendwann war da nur der See, das Boot, der Himmel, wir – da war ich glücklich“. Ein Erinnerungsbild.
Ein anderes: Da sind die für seine Jungs Ullrich und Stephan, auf deren Werdegang im Leben er später mit so viel stillem Stolz blickte, ausgestellten Vollmachten für den Erwerb der Zigarettensorte „Jubilar“, wenn die Satzsucherei am Schreibtisch einfach kein Ende finden wollte. Und alles Arbeitselend der Welt, durchlittene Nächte, um einem Satz oder zweien den letzten Schliff zu geben, wurden aufgewogen von Hohen Neuendorf, jenem kleinen Paradies bei Berlin, das Wruck – ganz gegen den landesüblichen Sprachgebrauch – nicht Datsche, sondern „unseren Landsitz“ nannte. Hier kamen Freundinnen und Freunde zusammen. Wer einmal unter den hohen Bäumen in jener Naturbelassenheit gesessen hat und sich an einem warmen Sommerabend von den liebenswürdigen Gastgebern mit frischem Brot und kühlem Wein hat bewirten lassen, der vergisst da nichts und hat am Vergangenen Freude noch heute. Die Familie erlebte sich, wie mir die beiden großen Söhne im dankbaren Erinnern erzählten, gegenüber dem beengten Pankower Domizil plötzlich auf ganz neue, leichte Weise – morgens holte einer Brötchen, ein anderer kochte Kaffee, jemand stellte Teller und Tassen auf dem Holztisch bereit: und das Gespräch ging lebhaft und fröhlich, unbeschwert und heiter, als könnte es nie enden. Der Rat, den man erhoffte, kam wie von selbst, und als man sich, wie es so gehen mag und geht, aus dieser Welt herauswuchs, war doch diese Welt eine des Vaters, den man als Freund wusste, dem man Freund war und dessen Zuneigung trug. Dazu mochte später auch das Ritual zählen, alljährlich am 24. Dezember die Familie in der Achtermannstraße um einen Tisch zu versammeln, auf dem ihr „Karpfen blau“ liebevoll vorgesetzt wurde. Ob schlesisch zubereitet? Ich weiß es nicht, aber ich möchte es mir denken, jetzt für uns hier. Bilder des Genießens und der Lebenslust. Die lachenden Schwiegertöchter Reila und Daniela, denen er zugetan war und über die er mit Wärme sprach, die Enkelinnen und Enkel … Oder die langjährigen Freunde, die, alt nun alle, wandernd von Zeit zu Zeit durch die Mark zogen: Klaus Hermsdorf, Peter Müller, und der liebste aller Freunde, Gerhard Schneider. Ich werde Wrucks Gesicht nicht vergessen, als er mir von dem Dank erzählte, den er seinem fast gleichaltrigen Hochschullehrer am Sterbebett noch abstatten durfte: für ein Leben in Freundschaft. Zum älter werden gehört Tapferkeit. Herr Wruck war tapfer, und er war traurig über jeden Verlust, den das Alter brachte. „Es wird langsam einsam, Herr Berbig“, sagte er mir bei unserer letzten Begegnung, einer herbstlich-heiteren Weinprobe am Wittenbergplatz, zu der er mich geladen hatte.
Bilder der Freude verbanden sich – wie oft habe ich Herrn Wruck davon erzählen hören – mit Lucas, seinem dritten Sohn. Noch einmal stand über allem ein Beginnen, ein Anfang, ein Nochmal. Unbeschwerte Reisen mit Barbara in jene Ferne, in die es Peter Wruck immer wieder zog. Einen olympischen Wettlauf auf klassischer Strecke mit kleinen Jungen zu veranstalten und dabei übermütig in das griechische Licht zu blinzeln, dessen fernes Herkommen ihm gegenwärtig war …, Zeichnungen mit dem Stift, wie es von früh an erprobt worden war, nun Lucas an seiner Seite. Ausflüge durch das klassische Rom, mit dem Baedeker und allerlei Literatur sachgerecht vorzubereiten, das war ein Ja zu jenem Dasein, um dessen Herrlichkeit und um dessen Gebrechlichkeit er wusste und das er doch mit Herz und Sinnen liebte. Der als junger Mann eine durchtanzte Nacht zu schätzen wusste, der schätzte diese Erinnerung so sehr, dass er es im Alter noch einmal wagte, mit einem Tanzkurs zu beginnen. Aufmerksamkeit, heißt es in Paul Celans Meridian-Rede in Anlehnung an Benjamin, ist das natürliche Gebet der Seele. Von dieser Aufmerksamkeit allem Sein gegenüber hatte Peter Wruck viel. Geschichten, Bilder, wer könnte sie ergänzen, wenn nicht Sie und ein jeder, eine jede von uns.
Gleichbehandlung: Peter Wruck war das Lebensgesetz. Es einzuhalten, fiel ihm leicht. Es entsprach seinem Wesen. Wem er begegnete, dem begegnete er auf Augenhöhe. Eine soziale Differenz zu markieren, war ihm fremd. Dünkel oder Neid, Eitelkeit oder Ehrsucht vertrugen sich nicht mit einer Haltung, die von weither kam und in der ein Gran Schlesisches vermutet werden darf. Feinsinnige Ironie, deren Schutz er bedurfte, stand vorbehaltfreie Freundlichkeit zur Seite, die nicht vergisst, wer sie erfuhr. Mit keinem Menschen habe ich lachen können wie mit ihm. (Einmal habe ich darüber und ohne jede Reue mehrere Anschlusszüge verpasst.) Für die Neigung, Wörter zu gebrauchen, die außer Gebrauch gekommen waren, mochten wir ihn – sehr. „Leibesübung“ für die tägliche Fitness, „Muttersbruder“ für den Onkel und als Wunsch für den jüngsten Sohn jene altertümliche „Tüchtigkeit“ – Worte, die in seinem Munde die Kraft ihres Ursprungs zurückgewannen … Als sein Gedächtnis ihm nicht mehr gehorchte, wie er es sein Lebtag gewohnt war, sprach er von „Wortfindungsschwierigkeit“, als hoffte er, mit dem Begriff die Not zu bannen. Nur wer wusste, wie sehr ihm das gefundene und einzig passende Wort allzeit Glück war, ahnte vom Unglück, das ihm der Verlust dieser kostbaren Gabe bedeutete. Jahrzehnte haben wir von dieser Kunst dankbar profitiert und unsere Herzensfreude an ihr gehabt.
Zum Schluss ein letztes Erinnerungsbild. Es ist, wie es der Anlass gebietet, ein Bild des Abschieds. Noch einmal steht Peter Wruck vor uns. Ein geglücktes, glückliches Zusammensein ist an sein Ende gelangt. Wir nehmen seinen Mantel, reichen ihm Schal und Kopfbedeckung. Als wir ihm behilflich sein wollen, sagt er: „Das geht schon noch allein, bin ja froh darüber“. Er setzt die unverzichtbare, immer etwas sonderliche Mütze auf, wir schütteln einander die Hand, in einem Zugeneigtsein, das keiner Worte bedarf. Und ehe er fortgeht, dreht er sich ein letztes Mal um, seine Augen funkeln fröhlich-ernst, weil er die Wendung gefunden hat, die den Abschied würdig besiegelt: „Leben Sie wohl“, sagt er. Und es ist, als habe er diesen alten, klassischen Trennungsgruß, der allen Wert birgt, in diesem Augenblick und nur für uns gefunden. „Leben Sie wohl!“
Jeder Mensch sei ersetzbar, heißt es. Ich glaube es nicht. Jetzt nicht, hier nicht – nie.