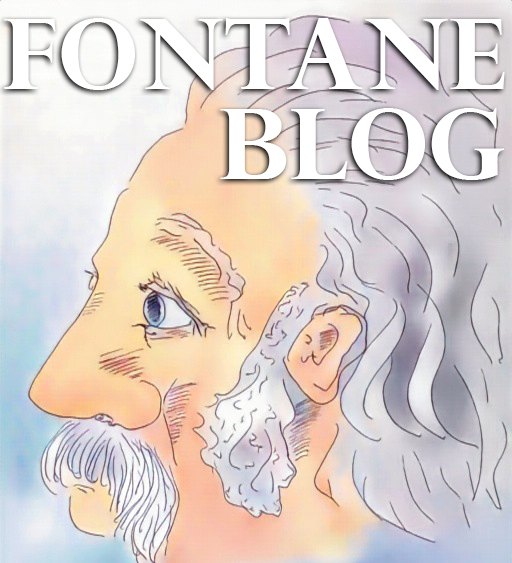Wer seit Jahren als Fontane-Blogger unterwegs ist, der fährt nicht einfach nur so ins Märkische: Allzeit hält er resp. sie Ausschau nach Fontane-Insignien. Gibt es dort, wo er sich umzutun gedenkt, Fontane-Zitate auf Schautafeln, ist möglicherweise ein Gedenkstein für ihn oder doch eine Tafel des Erinnerns angebracht, oder hat man versehentlich einen Flecken in der Mark angesteuert, für den sich unser Wanderer nicht interessiert hat. Der Fotoapparat sitzt locker, das Notizheft ist griffbereit. Unterwegs zwischen Neuhardenberg und Neuruppin, zwischen Potsdam und Paretz, stellt sich etwas ein, das mit „Fontane-Gefühl“ nicht übel bezeichnet ist.
Eher zufällig fiel diesmal die Auswahl auf Kloster Lehnin, unweit von Brandenburg. Offen gestanden: Die Herbstsonne lockte mehr als Historisches, und mehr als klösterliches Dunkel reizte die Aussicht auf einen Kaffee mit selbstgebackendem Kuchen im Freien. Vor Jahr und Tag hatte einmal ein Tagesausflug der Theodor Fontane Gesellschaft nach Lehnin geführt. Und wie es da zu gehen pflegte, war man in netter Runde durch Backsteingänge geschlendert und hatte weit mehr dem Plauderwort rechts und links gelauscht als den kundigen Worten des ansässigen Pfarrers.
Fontane war im Spätherbst 1863 auf Erkundungstour in Lehnin und Umgebung gewesen, gleich zweimal: den ersten Ausflug im Oktober unternahm er allein, den zweiten – am 26. November des Jahres – mit Bernhard von Lepel, dem Freund aus alten Tagen, und einem jungen Architekten, Richard Lucae, der ebenfalls zum literarischen Kreis Rütli gehörte. Wie immer ließ er es an Gewissenhaftigkeit nicht fehlen. Den Ausflügen folgte Stoffsammeln. Das Grobgesichtete bedurfte vielfältiges Material um in Feinbeobachtetes literarische Gestalt zu gewinnen. Über das Auskundschaften vor Ort schien Fontane allerdings schon vor Fertigstellung mit dem einen oder anderen gesprochen zu haben.
Heinrich Pröhle, selbst vom Fach regionaler Historik und Herausgeber einer Zeitschrift mit dem Titel Das Vaterland, war davon so angetan, dass er sich Fontane als Referenten in einer Vortragsrunde wünschte. Der indes hatte kopfschüttelnd abgelehnt. Das Nein kleidete er in fast Bekenntnishaftes: Es sei Gesetz „bei mir, mit nichts herauszutreten, das nach meiner Meinung nicht fertig oder doch für einen bestimmten Zweck ungeeignet ist. […] “ Er habe das Zusammengetragene für eine ganz eigene Darstellung geordnet, zu viel sei ihm zugemutet, „wenn ich all das wieder umwerfen soll, um es in die Form eines Vortrags zu bringen. […]“ (Fontane an Pröhle, 11. Dezember 1863).
Aus welchen Gründen auch immer ließ er sich dann doch im Februar 1864 überreden und referierte über das märkische Kloster im Potsdamer Offizierskasino. Ein Vierteljahr strich noch ins Land, bis der Aufsatz den gewünschten Schliff und die nötige Faktendichte hatte, um im Wochenblatt der Johanniter-Ordens-Ballei Brandenburg in den Druck zu gehen. Und ein Jahrzehnt seit den Ausflügen waren vertrichen, als aus dem Aufsatz ein Buchkapitel geworden war, das Aufnahme in dem 1873 bei Wilhelm Hertz herausgekommenen Wanderungenband Osthavelland gefunden hatte. In Fontanes Notizbuch A 14 sind 14 kleine Seiten mit Stichworte gefüllt, die im November 1863 eingetragen wurden. (Wie schade, dass die Notizbücher-Edition, auf die Gabriele Radecke im Jubiläumsjahr mit so viel Nachdruck aufmerksam gemacht hat, offenbar zum Erliegen gekommen ist).
Nun also meine zweite Wanderung ins Havelländische und zum Kloster Lehnin. Natürlich mit dem Havelland-Band auf den Knien – und natürlich nicht per pedes, nicht einmal auf dem Drahtesel, sondern auf der Rückbank eines Autos. Ich überflog die Seiten, die der Überschrift „Die Zisterzienser in der Mark“ folgten, nahm flüchtigen Auges den Unterschied zwischen Zisterzienser und Bendiktiner Klöstern auf – um endlich an dieser Stelle zu verharren: „Das wichtigste unter den aufgezählten märkisch-lausitzischen Klöstern war wohl das Kloster Lehnin. Es wurde das Mutterkloster für diese Gegenden, aus dem Neuzelle, Paradies, Mariensee, Chorin und Himmelpfort hervorgingen.“ (GBA-Havelland, S. 42).
Wie hübsch Fontane, auch noch für eine heutige Leserschaft, den segensreichen Einfluss jener Orden herauszustreichen verstand, und wie trefflich er zu vermerken wusste: „Die Klöster selber hin. […] Überall, wo in den Teltow- und Barnim-Dörfern, in der Uckermark und im Ruppinschen alte Feldsteinkirchen aufragen mit kurzem Turm und kleinen niedrigen Fenstern, überall, wo die Ostwand einen chorartigen Ausbau, ein sauber gearbeitetes Sakristeihäuschen, oder das Dach infolge späteren Anbaues eine rechtwinklige Biegung, einen Knick zeigt, üerall da mögen wir sicher sein – hier waren Zisterzienser, hier haben Zisterzienser gebaut und der Kultur und dem Christentum die erste Stätte bereitet.“ (GBA-Havelland, S. 43)
So las ich murmelnd auf dem Rücksitz – und musste doch bald erkennen, dass meine Mitreisenden dem kaum mehr als eingeschränktes Interesse entgegenbrachten. Sie schauten, was ihren Augen geboten wurde: und das war reichlich. Erst ein Parkplatz miit vielen Kraftfahrzeugen, dann allerlei Schilder mit Wegzeichen, die das Kloster als Anlage von mehreren Häusern auswies, und romantisch Verfallenes, das zur spielerischen Rekonstruktion einstiger Funktionen einlud. Buntes Laubwerk bot durch die Sonnenstrahlen, die es durchdrang, wechselndes Licht – die Versuchung, stehen zu bleiben und einfach nur zu schauen, war groß, ihr nachzugeben unwiderstehlich.
Erst ein Parkplatz miit vielen Kraftfahrzeugen, dann allerlei Schilder mit Wegzeichen, die das Kloster als Anlage von mehreren Häusern auswies, und romantisch Verfallenes, das zur spielerischen Rekonstruktion einstiger Funktionen einlud. Buntes Laubwerk bot durch die Sonnenstrahlen, die es durchdrang, wechselndes Licht – die Versuchung, stehen zu bleiben und einfach nur zu schauen, war groß, ihr nachzugeben unwiderstehlich.
Alles Geschichtliche, alles Große versank vor dem Glanz des Augenblicks. Ein Licht, das man Sterbenden wünscht zuletzt, ein Leuchten, das dem Lebenden Ängste nimmt. Der Fuß geht eigene Wege, er braucht den Kopf, der eine Richtung weist, nicht. Und dennoch steht man bald vor dem Tor des Kirchgebäudes, seine Anziehungskraft wirkt allzeit.
Indes: Allem Verzaubern erfolgt Ernüchterung. Es ist 12 Uhr, freundlicher Glockenklang, das ja, aber – die Kirchtür ist verschlossen, fest und unerbittlich. Ein Schild verkündet, erst um 14 Uhr werde es den Besuchswilligen geöffnet. Zwei Frauen, in fröhlichem Gespräch, freuen sich, als ich sie anspreche. Nein, sie hätten mit dem hier nichts zu tun, Teilnehmerinnen an einem Kräuterkurs seien sie, um die Öffnungszeiten des Klosters hätten sie sich noch gar nicht gekümmert. Ihr unbekümmertes Lächeln vertreibt den sich regenden Kummer. Wir blicken uns um und entdecken ein Schild, das uns eine Konditorei, ein Café verspricht. Und wirklich, ein paar hundert Schritte weiter öffnet sich dem Blick eine Terrasse mit Stühlen und Tischen und einem dahinter gelegenen Café – genauer: Kloster-Café Fiedler.

Doch damit nicht genug: Auf dem Weg dorthin winkt dem Fontane-Blogger eigentlicher Lohn. Er ist nicht umsonst hierher gepilgert, sein Fontane-Sinn, er hat nicht getrogen. Während seine Begleitung nach rechts gen Kaffee und Kuchen abdriftet, schwenke ich nach links. Da steht, gut sichtbar und gestalterisch umgebungsgerecht, eine Tafel. Was sage ich: Tafel, nein – eine Fontane-Beschilderung. Und als wäre das nicht schon das Erhoffte, sticht sogleich Exquisites ins Auge: der Name Emilie Fontanes! Das wird umgehend im Bild blog-fest gemacht. Was immer noch der Lehnin-Auflug bringen mag, er war nicht umsonst! 

Die Wartezeit verstreicht wie im Fluge, der Rückweg führt an kirchlich genutzten Stätten vorbei, Kita und Tagungsgebäude, Veranstaltungsankündigen und dergleichen mehr.
Und endlich stehen wir in der Klosterkirche St. Marien! 1180 hatte Markgraf Otto I. das Kloster gegründet, bis 1260 war man mit Bau und Einrichtung beschäftigt, bis dieses Gemisch von romanischem und frühgotischem Baustil seine Bestimmung erreicht hatte. Das Innere des Gebäudes lehrt leises Staunen, der Flügelaltar, die dreischiffige Pfeilerbasilika in ihrer Gesamtheit ––– ein etwas spartanisch gehaltenes Informationsblatt unterrichtet maßvoll. Aber im digitalen Zeitalter kein Grund zum Verdruss. Rasch ist eine Webseite aufgerufen, und man muss bedacht sein, über das Lesen nicht das Schauen zu versäumen. Am Ein- und Ausgang der obligatorische Kartenständer und Kollektekasten: und wahrhaftig – drei Schwarz-weiß-Ansichtskarten werden angeboten, deren Geburtsland die DDR war. Für drei Euro erwerbe ich, was einmal zusammen 60 DDR-Pfennige gekostet hat, und ziehe vergnügt fort.
Am Auto steht meine Reisebegleitschaft und drängt auf Aufbruch. Kaum rollen wir auf dem Kopfsteinpflaster, dreht sich die Fahrerin zu mir um: „Du hast doch die ganze Zeit Fontane gelesen. Warum heißt das eigentlich Lehin hier?“ Das ist mein Moment, ich darf ihn getrost als glücklichen Abschluss adeln. Sogleich hole ich den Wanderungen-Band hervor und lese, heiter beschwingt, was dazu bei Fontane steht:
Diesen Vorgang erzählt der böhmische Schriftsteller Pulkava (wie er ausdrücklich beifügt, „nach einer brandenburgischen Chronik“) wie folgt: >>OttoI., der Sohn Albrechts des Bären, jagte einen Tag lang in den dichten Waldrevieren der Zauche und warf sich endlich müd und matt an ebender Stelle nieder, wo später Kloster Lehnin erbaut wurde. Er schlief ein und hatte eine Vision. Er sah im Traum eine Hirschkuh, die ihn ohne Unterlaß belästigte. Endlich ergriff er Bogen und Pfeil und schoß sie nieder. Als er erwachte und seinen Traum erzählte, drangen die Seinen in ihn, daß er an dieser Stelle eine Burg gegen die heidnischen Slaven errichten solle — die andrängende, immer lästiger werdende Hirschkuh erschien ihnen als ein Sinnbild des Heidentums, das in diesen Wäldern und Sümpfen allerdings noch eine Stätte hatte.
Der Markgraf erwiderte: >eine Burg werde ich gründen, aber eine Burg, von der aus unsere teuflischen Widersacher durch die Stimmen geistlicher Männer weit fortgescheucht werden sollen, eine Burg, in der ich ruhig den Jüngsten Tag erwarten will.< Und sofort schickte er zum Abt des Zisterzienser-Klosters Sittichenbach, im Mansfeldischen, und ließ ihn bitten, daß er Brüder aus seinem Konvente, zur Gründung eines neuen Klosters, senden möchte. Die Brüder kamen. Markgraf Otto aber gab dem Kloster den Namen Lehnin, denn Lehnije heißt Hirschkuh im Slavischen.<< So der böhmische Geschichtsschreiber. (GBA-Havelland, S. 45)
Und so ich – seelenvergnügt.