
Der Schriftsteller Günter de Bruyn, der sich leise und respektvoll in einer Fontane-Nachfolge wusste, ist am 4. Oktober 2020 kurz vor vollendetem 94. Lebensjahr gestorben. Die Familie ließ, ganz im Sinne des Verstorbenen, ein paar Tage verstreichen, ehe die Nachricht an die Presse weitergereicht wurde. Medialer Spektakel, selbst gut gemeinter, misshagte dem Autor der Märkischen Forschungen (Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 1978), einer Erzählung, die genügt hätte, ihm einen angese-henen Platz in der deutschen Literaturgeschichte zu sichern.
Wahrlich, ein biblisches Alter. Von seinem katholischen Sinn hat er nie viel Aufsehens gemacht, wie er überhaupt die Welt bevorzugt aus einer Perspektive wahrnahm, der er einen Buchtitel widmete: Abseits (Frankfurt am Main: S. Fischer 2005). Im engeren Sinne war dieses Abseits eingebettet in märkischen Landschaften. Es wurzelte in den vergangenen literarischen und kulturellen Welten des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert. Verstand de Bruyn sich bis 1989/90 vornehmlich als Romanschriftsteller, so verlagerte er danach sein Schreibinteresse auf das Terrain preußischer Kulturgeschichte. Hier schien endgültig durch, was einer aufmerksamen Leserschaft schon lange aufgefallen war: dass de Bruyn eine unübersehbare Affinität zu Theodor Fontane erkennen ließ. Zu ihr bekannte er sich in der ihm eigenen Zurückhaltung, aus der heraus einige der bedachtsamsten Arbeiten zu Fontane der jüngeren Zeit entstanden (etwa die Auswahl Die schönsten Wanderungen durch die Mark Brandenburg, zuerst in der von ihm und Gerhard Wolf herausgegebenen Reihe „Märkischer Dichtergarten“, Berlin: Der Morgen 1988). Sie schloss unbestechlichen Urteilssinn nicht aus, ganz im Gegenteil.
 Darüber ist hinlänglich geschrieben worden. Hier genügt der kleine Fingerzeig. Auch mag der, der ihn gibt, nicht in den Nachruf-Tonfall geraten. Was dieser Tage in den Feuilletons steht, hat alles seine Richtigkeit. Unterbliebe es, wäre eine Unterlassung zu beklagen und die Lücke zu schließen. Das Bild, das sich abzeichnet, wird nicht auf Widerstand stoßen, freundliche Zustimmung ist ihm sicher. Man sieht es sich so gerne an, und dabei gerät in Vergessenheit, dass es sich um ein Bild handelt: ein schützendes Selbstbild, vielleicht, aber ein gewünschtes Fremdbild gewiss. Wir neigen dazu, was uns sympathisch ist, zu verein-nahmen und Befremdliches, wo es aufscheint, zu eliminieren. Tritt es dann, irgendwann einmal, später, zu Tage, verfallen wir in die Pose der Getäuschten und gefallen uns darin.
Darüber ist hinlänglich geschrieben worden. Hier genügt der kleine Fingerzeig. Auch mag der, der ihn gibt, nicht in den Nachruf-Tonfall geraten. Was dieser Tage in den Feuilletons steht, hat alles seine Richtigkeit. Unterbliebe es, wäre eine Unterlassung zu beklagen und die Lücke zu schließen. Das Bild, das sich abzeichnet, wird nicht auf Widerstand stoßen, freundliche Zustimmung ist ihm sicher. Man sieht es sich so gerne an, und dabei gerät in Vergessenheit, dass es sich um ein Bild handelt: ein schützendes Selbstbild, vielleicht, aber ein gewünschtes Fremdbild gewiss. Wir neigen dazu, was uns sympathisch ist, zu verein-nahmen und Befremdliches, wo es aufscheint, zu eliminieren. Tritt es dann, irgendwann einmal, später, zu Tage, verfallen wir in die Pose der Getäuschten und gefallen uns darin.
Meine persönliche Bekanntschaft mit Günter de Bruyn geht bis in die achtziger Jahre zurück. Man trug mir die Moderation einer Lesung des Romans Neue Herrlichkeit (Frankfurt/Main: S. Fischer 1984, Halle/Saale: Mitteldeutscher Verlag 1985) – von dessen mühseliger Veröffentlichungsgeschichte ich damals noch nichts Verlässliches wusste – im Rahmen eines „Internationalen Hochschulferienkurses“ auf. Dabei handelte es sich um ein akademisch-unterhaltsames Angebot der Humboldt-Universität an ausländische Studierende, die die Kosten in ihrer jeweiligen Währung trugen. Wie man auf mich kam, weiß ich nicht, es freute mich und versetzte mich in jene Anspannung, die Begegnungen mit prominenten Autorinnen und Autoren aus der DDR prägte. Veranstaltungsort war die „Mensa Nord“, unweit dem „Deutschen Theater“. Sie existiert nicht mehr. Als ich in der Universitätsbibliothek letzte Vorbereitungen auf A5-Blätter brachte (sehr unpraktisch), hatte ich nur wenige Tischreihen entfernt, Herrn de Bruyn entdeckt – natürlich ohne mich zu erkennen zu geben. Ich schlug, um nicht in Vorgesprächsverlegenheit zu geraten, einen weiten Bogen, um zur Mensa zu ge-langen. Kaum dort eingetreten, stand mir, ehe ich mich recht versah, der hochgewachsene Autor gegenüber. „Sind Sie Herr Berbig?“ – „Ja“, stotterte ich – und stotterte mich gleich weiter in die an sich völlig unsinnige Bemerkung, dass ich ihn vorhin schon gesehen habe, im Bibliothekssaal. Da wäre ich ihm schön öfters begegnet, auch wenn er mich sicher nicht … Und so fort. „Dort, ach, ja“. De Bruyn schien nicht minder verlegen, er suchte nach etwas Anknüpfenden. Es lag ihm nicht auf der Hand, wie auch, aber plötzlich mir. Denn während ich in meiner Umhängetasche nach den A5-Notizblättern kramte, murmelte ich: „Mich interes-siert der Tunnel, Fontane, wissen Sie, die haben da viel …“. Unsere beidseitige Verlegenheit – ich schwöre es – verlor sich schlagartig. Und als ich meinem Gestammel ein paar „Tunnel“-Namen hinterherschob, „Kugler-Lessing, Heyse-Hölty, Eggers-Anakreon“ und „da gibt es noch viel zu entdecken“, da erhellte sich de Bruyns Miene, alles Angestrengte verlor sich. Er nahm mich bei der Schulter, schleuste mich aus dem Gebäude und sah mich, während er nach einer Zigarette fingerte, neugierig an. „Erzählen Sie, das interessiert mich ja sehr, wissen Sie“, sagte er mit leichtem Lispeln und wies auf den Rand eines Sandkastens, „setzen wir uns doch hier hin“. Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer strömten an uns vorbei, die Uhr am Gebäude rückte rasch voran, wir erhöhten das Gesprächstempo und betraten, beide beinahe unwillig, auf die letzte Sekunde den Lesungsraum. Als ich mit der Vorstellung des Gastes begann, nannte ich rasch zwei, drei Romantitel, deutete das möglicherweise Brisante des gleich zur Rede stehenden Buches an, um dann völlig blödsinnig über eine in de Bruyns Augen eher angelegene Publikation von ihm in den Fontane Blättern ins Schwärmen zu geraten. Heute weiß ich, dass ich damit einem üblen Burschen, der als IM einen Bericht von der ‚heiklen Debatte‘ zu schreiben hatte, höchst unfreiwillig einen Gefallen erwiesen hatte. Indes: Zwi-schen de Bruyn und mir war ein Faden geknüpft. Ich ahnte nichts von dessen Haltbarkeit und schon gar nicht, dass aus ihm in den nächsten Jahren nach und nach ein Korrespondenz- und Begegnungsnetz entstehen sollte.
Als Peter Wruck, der die schöne Idee dazu hatte, mit mir einen „Fontane-Tag“ am literaturwissenschaftlichen Institut der Humboldt-Universität zu installieren, und wir nicht anstanden, in den Tagen lebhaftester deutscher Geschichte den zweiten Fontane-Tag am 19. Januar 1990 dem literarischen Verein Tunnel über der Spree zu widmen, da saß im buntge-mischten Ost-West-Auditorium zu unserer Freude und zum allgemeinen Erstaunen auch Günter de Bruyn.
Mir bereitete es in den langen Jahren, die diesem merkwürdigen Ereignis (Jens Bisky hat darüber einmal mit liebenswürdiger Ironie geschrieben) folgten, Spaß, nach Görsdorf, einem Ortsteil von Tauche, wo de Bruyn lebte, sich ansammelnde Kleinigkeiten aus diesem Fontane-Pool zu schicken. Die Rückmeldungen, so knapp sie ausfielen, so freudig-interessiert blieb immer ihr Ton. Das Bekanntschaftsband verlängerte. Meine Schnipsel wurden überreich belohnt: Jedes neue Buch lag, freundlich gewidmet, in meinem Postkasten. Trafen wir ei-nander, rückten wir umgehend den dritten Stuhl an den Tisch, auf den wir „Theodor Fontane“ setzten. Als wir Dezember 1990 eine dem Dichter gewidmete literarische Gesellschaft aus der Taufe hoben, hatte sich auch de Bruyn unter die Gästeschar gemischt, ein bisschen belustigt, „was das wohl wird“, und kopfschüttelnd, als seine Kollegin Gisela Heller mit erhobener Stimme durch den Saal rief, wir dürften wohl sicher sein, dass „unser Fontane auch zu denen gehört hätte, die auf Leipzigs Straßen ‚wir sind das Volk‘ skandiert hätte“. Ein Kopfschütteln bewahrt das Gedächtnis auch bei der Entscheidung, die Bindestriche im Vereinsnamen fortzulassen: Theodor Fontane Gesellschaft.
 Universität und Literaturgesellschaft umwarben Günter de Bruyn fortan – beinahe in dem Maße, wie sein schriftstellerischer Ruhm zunahm. Einmal gab er bei einer Jahrestagung sogar den Rei-seführer und ließ sich von einem schwankenden Bus auf mise-rablen Straßen nicht abhalten, höchst engagiert mit fontane-schem Blick auf die Marwitzer Gegend im Oderland zu schauen. Die Humboldt-Universität folgte einem Vorschlag seines Instituts für deutsche Literatur und verlieh ihm am 4. November 1998 den „Ehrendoktor“ – eine Würdigung, die die Friedrich-Wilhelms-Universität seinem so geschätzten Vorgänger Theodor Fontane 104 Jahre zuvor hatte zuteilwerden lassen. Der Ton, in dem de Bruyn seine Dankesrede sprach, die dem alten Fontane gewidmet war, ist unvergessen. Langsam, sich immer wieder seines Gegenstandes vergewissernd – ganz im Wunsch, seine Zuhörerschaft für die schwierige Sache, um die es ging, zu gewinnen.
Universität und Literaturgesellschaft umwarben Günter de Bruyn fortan – beinahe in dem Maße, wie sein schriftstellerischer Ruhm zunahm. Einmal gab er bei einer Jahrestagung sogar den Rei-seführer und ließ sich von einem schwankenden Bus auf mise-rablen Straßen nicht abhalten, höchst engagiert mit fontane-schem Blick auf die Marwitzer Gegend im Oderland zu schauen. Die Humboldt-Universität folgte einem Vorschlag seines Instituts für deutsche Literatur und verlieh ihm am 4. November 1998 den „Ehrendoktor“ – eine Würdigung, die die Friedrich-Wilhelms-Universität seinem so geschätzten Vorgänger Theodor Fontane 104 Jahre zuvor hatte zuteilwerden lassen. Der Ton, in dem de Bruyn seine Dankesrede sprach, die dem alten Fontane gewidmet war, ist unvergessen. Langsam, sich immer wieder seines Gegenstandes vergewissernd – ganz im Wunsch, seine Zuhörerschaft für die schwierige Sache, um die es ging, zu gewinnen.
Ist das wirklich 22 Jahre her? Das sind so Fragen, Floskeln zumal, und sie taugen nichts. Eine kleine Korrespondenzmappe liegt vor mir, dazu Anzeigen von Verlagen, Notizen. „Corona“ vereitelte eine Tagung de Bruyn zu Ehren in diesem Sommer war geplant, das Kleist-Museum in Frankfurt/Oder hatte sich ins Zeug gelegt und als Kuratorin einer kleinen Ausstellung dort Dr. Christiane Barz an Bord geholt. Es ist noch nicht lange her, dass sie mir lebhaft von ihrem Besuch in Görsdorf plauderte – viel schriftstellerisches Material habe sie sichten dürfen, alles ganz wunderbar, ‚Fontane-getränkt‘ … Ich habe das Haus nie gesehen, in dem der Großteil von de Bruyns literarischem Werk entstand – und das ihn vor einer Welt schützte, der er etwas zu sagen hatte, sich ihr aber nicht ausliefern wollte.
Sein letztes Buch Der neunzigste Geburtstag. Ein ländliches Idyll (Frankfurt/Main: S. Fischer 2018) spiegelt bei allem erzählerischen Geschick, wie fremd ihm geworden war, was sich ‚dort draußen und überhaupt so tat‘. Ein Freund war erschrocken, als er die Erzählung las, eine Freundin erbat Bedenkzeit und ich? Ich sehe dieses Buch im Verbund mit einem langen schreibenden Leben, das seinen Eigensinn gewahrt hat und das keines Nenners bedarf, auf den es zu reduzieren ist. Noch lange möchte ich Günter de Bruyns Gesicht vor Augen haben und seine Stimme im Ohr, möchte aus dem Bücherschrank eins seiner Bücher nehmen, darin lesen, etwas Übersehenes entdecken und widersprechen, wo sich Widerspruch regt. Dann soll er, sich in der Unterhaltung öffnend und jene Wendung „wissen Sie“ wieder und wieder gebrauchen: nicht auf Einverständnis dringend, eher um Verstehen werbend – ein Augenblick freundlicher Zuwendung, wissen Sie.
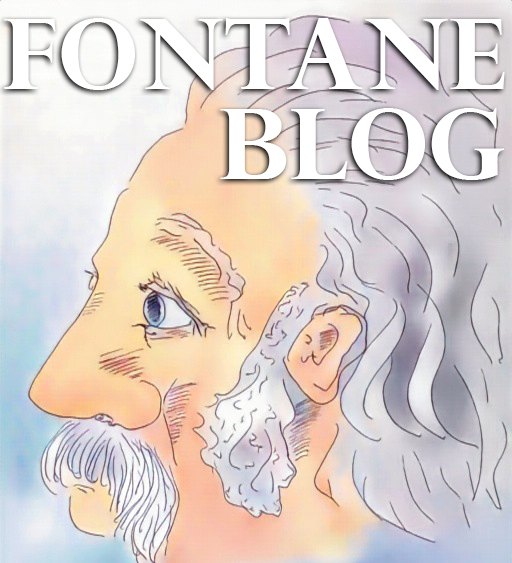
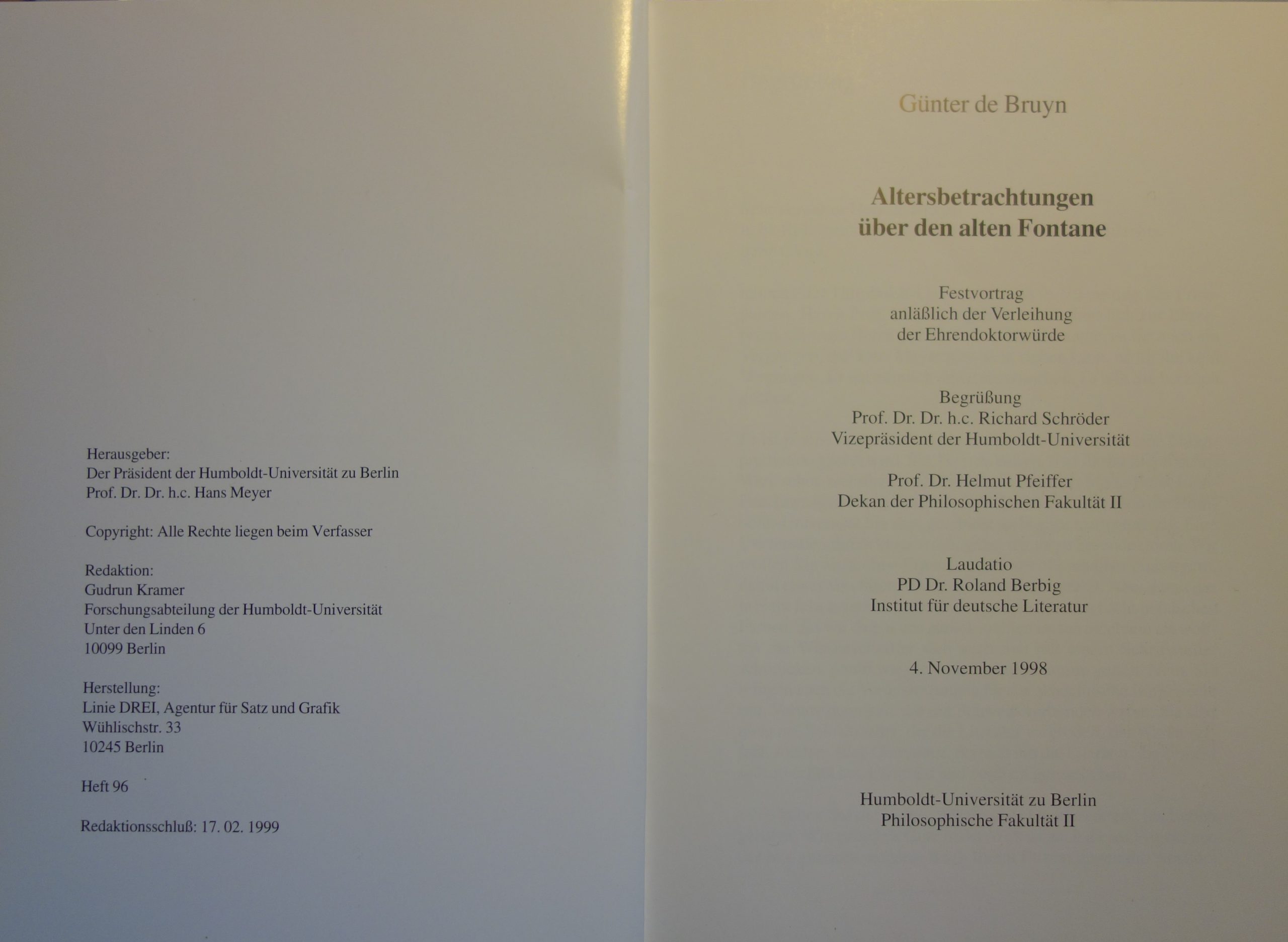
One comment