Eigentlich –
eigentlich ging es ausschließlich um einen erteilten Auftrag des Kulturausschusses der Bezirksverordnetenversammlung Friedrichshain-Kreuzberg.
Eigentlich –
eigentlich war die Verabredung, dass Georg Bartsch und ich um 10 Uhr vor der Amerika-Gedenkbibliothek, Blücherplatz 1 stehen, um uns dort nach einem geeigneten Platz für eine Fontane-Gedenkplatte umsehen.
Eigentlich –
und eigentlich sollte es nach der raschen Besichtigung gleich ans Beraten gehen – wenn möglich bei einem Kaffee.
Aber eigentlich –
eigentlich kam es anders. Der Auftakt war noch ganz im Maß. Ich war zuerst da, blickte schon einmal nach rechts und links und freute mich am noch vorhandenen Schnee. Anders der pünktlich und schon von Weitem winkende Herr Bartsch. „Hatte schon meine Winterschuhe weggepackt, dachte, das ganze Zeug ist heute früh weg – ist nicht mein Fall, überhaupt nicht!“ Unter Geplauder wie diesem ging’s zur Sache: In dieser Ecke also hatte Fontane mal gewohnt, ahja, die Straße, wo ging die lang? Ach, gar nicht hier, sondern im Bogen. Stehen noch Häuser von damals? Nein, nein, der Krieg. Aber hier, ungefähr hier … Die schneebedeckte Wiese vor dem Bibliotheksgebäude musterte uns wie wir sie. Zwei aufgestellte Scheinwerfer hielten wir für konkurrierende Gedenkplatten, eine Metallplatte schien fast für unsere Zwecke installiert. Wir betraten den Flecken, fotografierten ein wenig und waren bald einig: Ja, das ginge, entweder gleich vor der AGB oder ein Stückchen abseits, bei der Bank unter dem Baum.
Nun ein letztes Eigentlich –
eigentlich wollte Herr Bartsch, witterungsunwirsch, umgehend wieder ins warme Trockene, beging aber den Fehler, mich auf die nahegelegenen Friedhöfe am Halleschen Tor aufmerksam zu machen. „Oh, da war ich noch nie, ich wag’s gar nicht zu sagen. Wollen wir?“ Meine Frage klang in den Ohren meines Be-gleiters nicht nach einer Frage, er hörte heraus, was sie war: eine unternehmungslustige Aufforderung. Und gab, ein wenig unwillig und schicksalergeben, nach. Wer nun vermutet, ich hätte mir da einen Kulturbanausen als Begleiter ausgewählt, dem für die unbedingte Ausstrahlungskraft von Friedhöfen der Sinn fehle, der ist eines Besseren zu belehren. Auf Georg Bartsch‘ Schreibplatte liegen stattliche Manuskripte, ihr ausgewählter Gegenstand: Berliner Friedhöfe! Er ist ein Kenner dieses Faches, er weiß Bescheid – und zwar bestens. Das hieß: Jene Friedhöfe am Halleschen Tor sind ihm vertraut wie seine Westentasche. Warum also heute schon wieder dorthin – – –? 
Aber weil er ein freundlicher Mensch ist, zog er mit – und zog mich, kaum waren wir durch das Eingangstor getreten, selbst sogleich wieder entzündet, hinein in diese Welt der Toten. Und einmal beseelt, verwandelten sich dieses Reich des Todes in etwas Lebendiges. Literaturgeschichtliches Gestern trat in unser Heute, und wir beeilten uns, die Tür weit zu öffnen. Erinnertes Wissen, das sich fröhlich einstellte, wirkte, als sei es das Entrée Billet dorthin. Jeder bekannte Name, den wir auf den Grabsteinen entdeckten – und den mir vor allem mein Begleiter entdeckte –, schaffte eine Aura. Wir reckten und streckten uns. Wir lächelten, wir wandelten über Verschneites, als seien es die Wolken jenes Himmels, der all diese Geister aufgenommen hat, um ihnen bis zum Weltenende Heimstatt zu sein.

Dabei: Keinesfalls waren alle jene Geister, die wir angesichts ihrer Gedenksteine beschworen, große. Und gerade sie bereiteten uns Vergnügen. Wenn Herr Bartsch, mit einer Hand- und Kopfbewegung eine Linien quer über den Friedhof andeutend, meinte: „Das hier, das ist ungefähr eine Strecke, da liegen die Schauspielerinnen und Schauspieler, die in Fontanes Theaterkritiken vorkommen“ – dann, ja dann fiel der Blick auf längst Vergessene. Oder wer wird unbekümmert rufen „kenn‘ ich“, hört er den Namen von Paul Dehnicke? Der war immerhin einmal Königlicher Hofschauspieler. Das besagt einiges, gewiss nicht alles. Und was sagte Fontane über Dehnicke? Als der am 9. September 1870 – Fontane war noch jung im Amt des Theaterkritiker – den Pedell in Ernst Rau-pachs „Vor hundert Jahren“ gab, vermochte er nichts anders, als dessen Spiel „als verfehlt [zu] bezeichnen“. Dies sei kein Pedell, „dies ist ein Clown“. Das Publikum empfand es offenbar anders, denn Fontane sah sich veranlasst, „den trefflich beanlagten Schauspieler, dessen vis comica wir gerne anerkennen“, durch den Applaus „nicht auf Irrwege führen“ zu lassen (Theodor Fontane: Theaterkritiken 1870-1894. Hg. von Debora Helmer u. Gabriele Radecke. 4 Bde. Berlin: Aufbau 2018. Bd. 1, S. 21) Ein Jahr später, September 1871, geriet sein Schauspieler-Urteil ins Grundsätzliche: Es gebe zwar Rollen, in denen man sich Dehnickes Komik aufrichtig freue, „im Großen und Ganzen aber scheint er nur die eine Frage zu kennen: werden sie lachen oder nicht? Von wirklicher Kunst, deren Aufgabe darin besteht, verklärtes, aber nicht verzerrtes Leben darzu-stellen, kann dabei füglich nicht die Rede sein.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 76) Sollten wir, die wir da über den Friedhof spazierten, uns von jenem Manne rasch verächtlich abwenden? Keinesfalls. Unsere Lust und Laune wuchs. Wir wendeten uns um, und schon standen wir vor einer Art Stelen-Grab. Der helle Stein ähnelte einem faltenwerfenden Gewand, vielleicht auch einem Theatervorhang. Theodor Döring (1803-1878) lasen wir, auch er Schauspieler, auch er am Königlichen Schauspielhaus. Der kam besser weg, Fontane feierte ihn wiederholt und hielt sein Engagement für einen Glücksumstand, jedenfalls meist. „Der Nathan Herrn Döring’s und die Daja Frau Frieb’s sind in der glücklichen Lage“, heißt es in der Lessing-Kritik des „Nathans“, „unserer respektvollen Ver-beugung entbehren zu können.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 205) Das war hoch gegriffen. Als er Döring im Februar 1873 in Shakespeares „Heinrich der Vierte. I. Theil“ erlebte, legte er noch eins drauf, sprach von einer „Brillantleistung unseres Döring“, um die Frage anzuschliessen: „Wer soll dies nach ihm leisten? […] die Besten reichen ihm in dieser Rolle kaum bis ans Knie.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 268).
Ein Jahr später, September 1871, geriet sein Schauspieler-Urteil ins Grundsätzliche: Es gebe zwar Rollen, in denen man sich Dehnickes Komik aufrichtig freue, „im Großen und Ganzen aber scheint er nur die eine Frage zu kennen: werden sie lachen oder nicht? Von wirklicher Kunst, deren Aufgabe darin besteht, verklärtes, aber nicht verzerrtes Leben darzu-stellen, kann dabei füglich nicht die Rede sein.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 76) Sollten wir, die wir da über den Friedhof spazierten, uns von jenem Manne rasch verächtlich abwenden? Keinesfalls. Unsere Lust und Laune wuchs. Wir wendeten uns um, und schon standen wir vor einer Art Stelen-Grab. Der helle Stein ähnelte einem faltenwerfenden Gewand, vielleicht auch einem Theatervorhang. Theodor Döring (1803-1878) lasen wir, auch er Schauspieler, auch er am Königlichen Schauspielhaus. Der kam besser weg, Fontane feierte ihn wiederholt und hielt sein Engagement für einen Glücksumstand, jedenfalls meist. „Der Nathan Herrn Döring’s und die Daja Frau Frieb’s sind in der glücklichen Lage“, heißt es in der Lessing-Kritik des „Nathans“, „unserer respektvollen Ver-beugung entbehren zu können.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 205) Das war hoch gegriffen. Als er Döring im Februar 1873 in Shakespeares „Heinrich der Vierte. I. Theil“ erlebte, legte er noch eins drauf, sprach von einer „Brillantleistung unseres Döring“, um die Frage anzuschliessen: „Wer soll dies nach ihm leisten? […] die Besten reichen ihm in dieser Rolle kaum bis ans Knie.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 268). Und endlich, am 8. Februar 1874 in der Kritik zu Ifflands „Der Spieler“ verstieg sich Fontane in Formulierungen, die jede Steigerung ausschloss:
Und endlich, am 8. Februar 1874 in der Kritik zu Ifflands „Der Spieler“ verstieg sich Fontane in Formulierungen, die jede Steigerung ausschloss:
Seit 32 Jahren, wo wir Theodor Döring kennen, ver-danken wir ihm Genuß auf Genuß, mehr als irgend einem lebenden oder heimgegangenen Künstler. Nichts aber was wir von ihm gesehen, reicht an diese Rolle [gemeint war die des Hauptmann Posert] heran. Absolut vollendet. Fertig bis auf das letzte Stäubchen, und doch auch – kein Stäubchen zuviel. Das sind die Rollen, von denen nach 50 Jahren die Großväter sagen werden: „Kinder, dies ist alles nichts: da hättet ihr den alten Döring sehen sollen!“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 1, S. 392)
Eigentlich wäre es damit schon genug, aber kaum hatten wir uns Dörings Grab entfernt, standen wir schon vor der nächsten Ruhestätte eines großen Mimen: Gustav Carl Berndal. Kaum zu zählen die Einträge in Fontanes Theaterbesprechungen. „[K]lassisch und nach meinem Gefühl unübertroffen“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 2, S. 27-28) fand er ihn in Ifflands „Die Jäger“-Inszenierung, die am 30. Januar 1878 Premiere hatte. Freilich, war ein Stück wie etwa Bertold Auerbachs „Das erlösende Wort“ verunglückt, dann vermochte auch ein glänzender Schauspieler das Ganze nicht retten: „Namentlich Herr Berndal, in der Rolle des Professors, that sein Möglichstes. Umsonst.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 2, S. 79)  Dass Wertschätzung kein Abonnement hatte, bewies Fontane immer wieder. Auch Berndal musste das in Schillers „Wilhelm Tell“ (Titelrolle) schmerzlich erfahren, als Fontane nüchtern konstatierte: „das Ruhige glückt, das Leidenschaftliche bewegt nicht; […] Am meisten tritt dies in der Apelschuß-Scene hervor; das Knieen, Beten und Befühlen des Knaben nimmt hier gar kein Ende, und stört mich erheblich.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 2, 155)
Dass Wertschätzung kein Abonnement hatte, bewies Fontane immer wieder. Auch Berndal musste das in Schillers „Wilhelm Tell“ (Titelrolle) schmerzlich erfahren, als Fontane nüchtern konstatierte: „das Ruhige glückt, das Leidenschaftliche bewegt nicht; […] Am meisten tritt dies in der Apelschuß-Scene hervor; das Knieen, Beten und Befühlen des Knaben nimmt hier gar kein Ende, und stört mich erheblich.“ (Theodor Fontane: Theaterkritiken Bd. 2, 155)
Ganz versunken in diesen wieder ins Gedächtnis gerufenen Schauspielerreigen, vergesse ich fast, wer mich – in Gestalt eines respektablen Grabsteins, der nur etwas zugewachsen ist – gleich beim Eingang begrüßte und den heute ‚kein Mensch mehr kennt‘: Rudolf Löwenstein. Er teilte mit Fontane das Geburtsjahr 1819 und zeitweilig, mag sein, politische Standorte. Wirklich verbunden aber waren die beiden durch ihre gemeinsame Mitgliedschaft in einem literarischen Verein, dem „Tunnel über der Spree“.
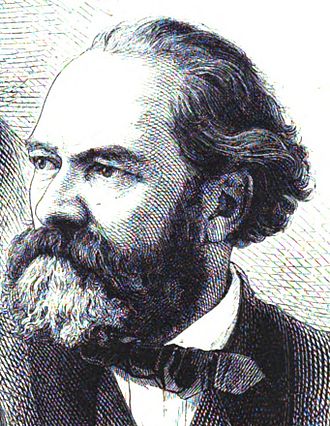
Hieß Fontane dort, etwas einfältig, Lafontaine, so Löwenstein, subtiler, Spinoza. Löwenstein erwarb sich schriftstellerischen Erfolg durch Kinderlieder, aber wesentlich doch als Mitbegründer der überaus einflussreichen Satirezeitschrift Kladderadatsch, deren Redakteur er lange Jahre war. Zwar erwähnte Fontane Löwensteins zeitweiligen Rückzug aus dem Verein – mit der Begründung, ihm sei „die Sache ‚zu reaktionär'“ (Theodor Fontane: Autobiographische Schriften. Hg. von Gotthard Erler, Peter Goldammer u. Joachim Krueger. Berlin, Weimar: Aufbau 1982. Band III: Christian Friedrich Scherenberg. – Tunnel-Protokolle und Jahresberichte. – Autobiographische Aufzeichnungen und Dokumente. Bearbeiter des Bandes Joachim Krueger, S. 64) –, aber in der Rückschau nobilierte er ein Geselligkeitsglanzstück ‚Spinozas‘:
Unter den alten [Vereinslieder] stand [beim Stiftungsfest] das von Rudolf Löwenstein gedichtete Tunnellied obenan, dessen erste Strophe lautet: „Zu London unter der Themse / Der mächtige Tunnel liegt, / Der Strom, scheu wie die Gemse, Hin über die Tiefe fliegt …“ Wir waren, wenn wir das sangen, immer in sehr gehobener Stimmung, beinahe gerührt, und noch in diesem Augenblick bezaubert mich ein gewisses Etwas in diesen vier Zeilen, […] (Theodor Fontane: Von Zwanzig bis Dreißig. Autobiographisches. Hg. v. d. Theodor Fontane-Arbeitsstelle, Universität Göttingen. Bearbeiter: Wolfgang Rasch. Berlin: Aufbau 2014, S. 178)
Wir, an Löwensteins letzter Ruhestätte, beugten unsere Köpfe über die Inschrift, musterten das Relief, das seine Konturen durch Wind und Wetter eingebüßt hat, und waren uns einig: ein grandioser Moment irgendwie. 
 Alles nicht wichtig, aber von jener Wichtigkeit, die uns zweien galt. Ich sehe die überschaubare Leserschaft dieses Blog-Beitrags lächeln – und lächele mit. Ja, ich weiß.
Alles nicht wichtig, aber von jener Wichtigkeit, die uns zweien galt. Ich sehe die überschaubare Leserschaft dieses Blog-Beitrags lächeln – und lächele mit. Ja, ich weiß.
Aber, rufe ich, das war beileibe noch nicht alles. Denn, wenn auch leicht fröstelnd, mein Friedhofsführer zeigte mit einem Male eine gewisse dringliche Unruhe. Habe ich auch schon einiges gesehen, das wirklich Hervorragende noch nicht. Beschleunigten Schritts durcheilten wir ein, zwei Wege, ließen allerlei Verlockendes links liegen, um endlich an einer Grabplattte anzugelangen und zu verharren. Georg Bartschs Miene betrübte sich. „Dieser Schnee“, murmelte er. Doch war sein Murmeln noch nicht verstummt, da hatte ich die Platte schon von der Schneedecke befreit und – versank in Andacht. Zum Vorschein war die Schrift auf der Grabplatte des großen deutsch-französischen Dichters Adalbert von Chamisso gekommen. Dessen Verskunst ließ – im Gegensatz zu der Fontanes – sogar die poetisch-professorale TÜV-Instanz, unser verehrter Ernst Osterkamp, gelten und war, für sie zu werben, sogar eine Zeitlang mit dem Schauspieler Hanns Zischler mit „Chamisso-Gedichten“ auf Lesereise gegangen. Mit engagierten Studierenden – mustergültig unterstützt von Jutta Weber und Monika Sproll / Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz – hatte ich vor Jahren ein Notizbüchlein von Chamissos transkribiert und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Und nun stand ich, gänzlich unerwartet, am Grab des Peter Schlemihl-Poeten. Dabei hätte ich’s wissen können, nein – müssen. Statt frischer Blumen legte ich in Gedanken ein paar kristallene Eisblumen auf diese Gedenkstätte. Wo hat, überlegte ich dabei, Fontane über Chamisso geschrieben? Natürlich: in den Wanderungen, im Oderland-Band, wo auch anders:
Dessen Verskunst ließ – im Gegensatz zu der Fontanes – sogar die poetisch-professorale TÜV-Instanz, unser verehrter Ernst Osterkamp, gelten und war, für sie zu werben, sogar eine Zeitlang mit dem Schauspieler Hanns Zischler mit „Chamisso-Gedichten“ auf Lesereise gegangen. Mit engagierten Studierenden – mustergültig unterstützt von Jutta Weber und Monika Sproll / Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz – hatte ich vor Jahren ein Notizbüchlein von Chamissos transkribiert und der interessierten Öffentlichkeit vorgestellt. Und nun stand ich, gänzlich unerwartet, am Grab des Peter Schlemihl-Poeten. Dabei hätte ich’s wissen können, nein – müssen. Statt frischer Blumen legte ich in Gedanken ein paar kristallene Eisblumen auf diese Gedenkstätte. Wo hat, überlegte ich dabei, Fontane über Chamisso geschrieben? Natürlich: in den Wanderungen, im Oderland-Band, wo auch anders:
Das Jahr 1813 brachte noch einen anderen Gast nach Schloß Cunersdorf und mit seinem Besuche schließen wir wie mit einem Idyll. Dieser Gast war Chamisso. Chamisso, bekanntlich infolge der französischen Revolution aus Frankreich emigriert, hatte als preußischer Offizier die unglückliche Kampagne von 1806 und speziell die Kapitulation von Hameln mit durchgemacht. Seitdem lebte er ausschließlich den Wissenschaften, besonders dem Studium der Botanik. Im Frühjahr 1813 waren seine Mittel erschöpft und Professor Lichtenstein, dem Itzenplitzschen Hause befreundet, empfahl den jungen Botaniker nach Cunersdorf hin, wo er, nach bald erfolgtem Eintreffen, die Anlegung einer großen Pflanzensammlung unternahm, eines Herbariums, das einerseits die Flora des Oderbruchs, andererseits alle Garten- und Treibhauspflanzen des Schlosses selbst enthalten sollte. Chamisso verweilte einen Sommer lang in dieser ländlichen Zurückgezogenheit und unterzog sich seiner Aufgabe mit gewissenhaftem Fleiß. Das von ihm herrührende Herbarium existiert noch. Die Mußestunden gehörten aber der Dichtkunst, und im Cunersdorfer Bibliothekzimmer war es, wo unser Chamisso, am offenen Fenster und den Blick auf den schönen Park gerichtet, den „Peter Schlemihl“, seine bedeutendste und originellste Arbeit niederschrieb. (Theodor Fontane: Wanderungen durch die Mark Brandenburg. Zweiter Teil: Das Oderland. Barnim-Lebus. Hg. von Gotthard Erler u. Rudolf Mingau. Berlin: Aufbau 1997, S. 185-186)
Und wahrscheinlich hätte ich an diesem Orte noch länger verweilt, hätte mich mein Begleiter nicht am Ärmel gezupft. „Das ist noch nicht alles, ich hab‘ noch etwas. Kommen Sie, es wird Sie freuen, denke ich …“ Ein letzter Blick, ein letzter Gruß – und weitergestapft. Bartsch, vorausgeeilt, warf mir einen erwartungsvollen Blick zu. Dort, wo seine Hand hinwies, ragte ein hell-bräunlicher Stein empor, beschriftet wie von Schreiberhand und mit einem goldgerandeten Schmetterling verziert: E. T. W. Hoffmann. Nach den Lebens- und Sterbedaten und dem Vermerk „Kammer Gerichts-Rath“ die Zeilen: „ausgezeichnet / im Amte / als Dichter / als Tonkünstler / als Maler / Gewidmet von seinen Freunden“. 
Warum ergriff mich dieser Augenblick so? Ich kannte Abbildungen von Hoffmanns Grab, hatte in Seminaren von ihm gesprochen und sogar den ge-nauen Standort „Friedrichshain-Kreuzberg Friedhof III der Jerusa-lems- und Neuen Kirche“ angegeben. Die Magie des Moments, unwiederholbar – auch nicht, in dem ich davon schreibe. Im langsamen Weitergehen erzählte Bartsch, zu Hoffmanns „Geburtstag“ am 24. Januar kämen alljährlich Liebhaber des kleinen-grossen Menschen, lesen Texte am Grab und trinken Rotwein dazu, „meist schlechten“ – und das letzte Glas schütten sie, weh- wie übermütig, auf die Bepflanzung am Stein. Was Fontane von Hoffmann hielt? Mir fiel wenig ein, kein großer Essay, kein Wort, das geflügelt die Nachwelt beflügelt. Irgendetwas mit den „Serapionsbrüder“ kam mir in den Sinn, ein Bezug zum „Rütli“, diesem Ableger der „Tunnel über der Spree“, oder Ähnliches. Richtig: zu Hause nachgeschlagen, ergibt sich zweifache Bestätigung – Hoffmann rangierte nicht unter Fontanes Leselieblingen, und wirklich, in dem langen, mit Gründlichkeit abgefassten und den literarischen Freundeskreis durchbuchstabierenden London-Brief vom 18. Februar 1858 an Wilhelm von Merckel (selber Kammergerichtsrat) kommt Fontane auf den Autor von „Klein-Zaches“ zu sprechen. Der Empfänger war es, der die „Serapionsbrüder“ ins Gespräch gebracht hatte. Durch seine Erwiderung, die Hoffmann und jener Runde immerhin „Genie“ bescheinigt, schimmern Respekt und Reserve in einem Federzug:
[…] Es ist das eigentümliche Vorrecht des Genies eine große Menge dummes Zeug zu sprechen und zu tun, was der anständige, gebildete Mensch nie gesprochen und nie getan haben würde, aber diese Schulmeister-Superiorität hilft dem letzern nichts, […] Hoffmann hat einen nachhaltigen Einfluß auf die Gestaltung der europäischen Literatur geübt; viele Literatur-Historiker führen die moderne französische Schule (Victor Hugo, Sue, etc.) auf ihn zurück. Nur bedeutende Erscheinungen, wie immer fehlerhaft und beklagenswert, üben solchen Einfluß. […] (Theodor Fontane. Werke, Schriften u. Briefe. Abteilung IV: Briefe. Erster Band: 1833-1866. Hg. Otto Drude u. Helmuth Nürnberger. München: Hanser 1976, S. 608-609)
Unser Friedhofsausflug neigte sich seinem Ende zu. Das Pflichtprogramm, das „Eigentliche“ also, es war weitgehend unerledigt. Wir hatten es beiseitegeschoben, wir hatten uns gehen lassen auf diesem Spaziergang. Nein, das sollte sich nicht rächen. Schnurstracks strebten wir Richtung Ausgang, indes da kreuzten doch noch zwei lokale Kostbarkeiten unseren Pfad, die erste anrührend, die zweite fontane-satt und schon deshalb Pflicht. Nicht anders als anrührend war es, als Bartsch mich an die Grabstätte des Geographen Johann Heinrich Barth (1821-1865) führte, dessen zwei Afrikareisen 1845-1847 und 1849-1855 ihn sichtlich faszinierten. Dem sei gelungen, sprach er mit andächtiger, gesenkter Stimme, woran Alexander von Humboldt gescheitert war: bis nach Timbuktu zu kommen. Und Bartsch fügte, fast noch leiser, hinzu: „Da bin ich auch gewesen, wegen ihm …“ Er sagte noch etwas, Feingefühltes, Persönliches – das gehört nicht hierher und bleibt mir im Gedächtnis.
Hierher gehört freilich das letzte besuchte Grab. Unbedingt. Nenne ich den Namen Albert August Degebrodt, muss ich vermutlich mit einem Achselzucken rechnen, selbst unter den Fontane-Kennern. Oder? So sieht es aus. Passgerechter als mit Degenbrodt zu schließen, ist für unsere Ortsbesichti-gung unmöglich. Das verlangt nach Erklärung. Sie liefert Fontanes Brief an Emilie vom 1. Juli 1862. Er beginnt mit einem Hochgesang auf das Erquickliche neueingesetzter Fliegenfenster, deren „frischen Luftströmungen“ ihm Labsal seien, ohne „jenes Gefühl der Erkältung, was sich bei offnen Fenstern gleich bei mir einstellt.“ Im Wissen, dass eine solche Nachricht Emilie freuen würde, schob Fontane mit entschlossenem Ruck das Unerfreuliche nach. Und das war von ganz anderem Kaliber:
Passgerechter als mit Degenbrodt zu schließen, ist für unsere Ortsbesichti-gung unmöglich. Das verlangt nach Erklärung. Sie liefert Fontanes Brief an Emilie vom 1. Juli 1862. Er beginnt mit einem Hochgesang auf das Erquickliche neueingesetzter Fliegenfenster, deren „frischen Luftströmungen“ ihm Labsal seien, ohne „jenes Gefühl der Erkältung, was sich bei offnen Fenstern gleich bei mir einstellt.“ Im Wissen, dass eine solche Nachricht Emilie freuen würde, schob Fontane mit entschlossenem Ruck das Unerfreuliche nach. Und das war von ganz anderem Kaliber:
[…] Lange werden wir die Fliegenfenster in dieser Wohnung nicht mehr benutzen, denn gestern am 30ten (ich wollte Dir nicht gleich gestern davon schreiben) ist Degebrodts Kündigung und zwar zum 1. Oktober d. J. durch den unvermeidlichen Wischer abgegeben worden. (Emilie und Theodor Fontane. Geliebte Ungeduld. Der Ehebriefwechsel 1857-1871. Hg. von Gotthard Erler unter Mitarbeit von Therese Erler. Berlin: Aufbau 1998, S. 230)
Emilie Fontane reagierte zwei Tage später, und man darf getrost sagen: gefasst. Sie schrieb, sie ärgere sich zwar sehr, „obgleich es aus vielen Gründen ganz gut ist, daß wir ziehen müssen, aber unverschämt bleibt es von dem alten Dicken doch.“ Recht habe er gewiss nicht, „uns quasi herauszuwerfen, die Leute müssen ja denken wir haben die Miethe schlecht bezahlt.“ Nie werde sie, so schloss dies Kapitel im Brief, werde sie Fontanes „beneidenswerthe Leichtigkeit“ erlernen, sich „in Alles zu finden“ (S. 232). Kurzum: Wir standen am Familiengrab jenes „Dicken“, der mit seinen Mietern so ungehörig umging. Der Allg. Wohnungs-Anzeiger nebst Adreß- und Geschäftshandbuch für Berlin, dessen Umgebungen und Charlottenburg auf das Jahr 1862 (Berlin: Hayn 1862), in dem sich noch dieses Wohnadresse Fontanes findet, weist ihn als Holzhändler aus, wohnhaft „Am Halleschen Thore 1. E.“ Von ihm bezogen Fontanes zeitweilig tatsächlich auch ihr Brennholz. Glücklich war man mit der Wohnung von Beginn an nicht gewesen. Sie war feucht. Fontane hatte seiner Mutter nach dem Einzug Herbst 1859 von „Dunst und Schimmel“ schreiben müssen (26. Oktober 1859. In: Theodor Fontane. Werke, Schriften u. Briefe. Abteilung IV: Briefe. Erster Band: 1833-1866, S. 682).
Kein Gran Sentimentalität kam uns an. Wir nickten uns einvernehmlich zu. Was für trefflich verbrachte Zeit lag da gerade hinter uns. Wie nebenher ging uns ein Licht auf: Die in dieser Ecke Berlins verlebten Jahre zwischen 1859 und 1862 waren für den schriftstellerischen Werdegang Fontanes von einschneidender Bedeutung: London hatte Weltläufigkeit gebracht – die Wanderungen nahmen ihren Anfang – der erste Roman wurde begonnen – eine feste Stelle bei der Kreuzzeitung sicherte den Lebensunterhalt – und im März 1860 erblickte Tochter Martha, an der Fontane so viel Freude haben sollte, das Licht der Welt.
Auf dem Weg in die nahegelegene Wohnung von Georg Bartsch, nun wieder, aber doch ganz anders den Auftrag im Sinn, einte uns ein Gedanke: So kann Leben sein – eigentlich.
Fotos vom Verfasser.
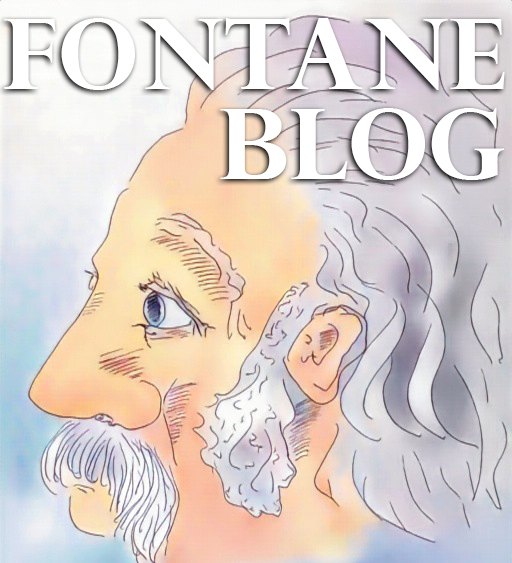
2 comments